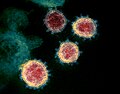Biologie
- oben: E. coli-Bakterien und Gazelle
- unten: Goliath-Käfer und Baumfarn ⓘ
| Teil einer Serie über ⓘ |
| Biologie |
|---|
|
|
Die Biologie ist die wissenschaftliche Erforschung des Lebens. Es handelt sich um eine Naturwissenschaft mit einem breiten Spektrum, die jedoch mehrere Themen vereint, die sie als ein einziges, kohärentes Gebiet zusammenhalten. So bestehen beispielsweise alle Organismen aus Zellen, die die in den Genen verschlüsselte Erbinformation verarbeiten, die an künftige Generationen weitergegeben werden kann. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Evolution, die die Einheit und Vielfalt des Lebens erklärt. Die Energieverarbeitung ist ebenfalls wichtig für das Leben, da sie es den Organismen ermöglicht, sich zu bewegen, zu wachsen und sich fortzupflanzen. Schließlich sind alle Organismen in der Lage, ihre eigene interne Umgebung zu regulieren. ⓘ
Biologen sind in der Lage, das Leben auf verschiedenen Organisationsebenen zu untersuchen, von der Molekularbiologie einer Zelle über die Anatomie und Physiologie von Pflanzen und Tieren bis hin zur Evolution von Populationen. Daher gibt es innerhalb der Biologie mehrere Unterdisziplinen, die jeweils durch die Art ihrer Forschungsfragen und die von ihnen verwendeten Werkzeuge definiert sind. Wie andere Wissenschaftler auch, wenden Biologen die wissenschaftliche Methode an, um Beobachtungen zu machen, Fragen zu stellen, Hypothesen aufzustellen, Experimente durchzuführen und Schlussfolgerungen über die Welt um sie herum zu ziehen. ⓘ
Das Leben auf der Erde, das vor mehr als 3,7 Milliarden Jahren entstanden ist, ist ungeheuer vielfältig. Biologen haben versucht, die verschiedenen Formen des Lebens zu untersuchen und zu klassifizieren, von prokaryotischen Organismen wie Archaeen und Bakterien bis hin zu eukaryotischen Organismen wie Protisten, Pilzen, Pflanzen und Tieren. Diese verschiedenen Organismen tragen zur biologischen Vielfalt eines Ökosystems bei, in dem sie spezielle Rollen im Nährstoff- und Energiekreislauf ihrer biophysikalischen Umgebung spielen. ⓘ
Biologie oder historisch auch Lebenskunde (von altgriechisch βίος bíos „Leben“ und λόγος lógos hier: „Lehre“, siehe auch -logie) ist die Wissenschaft von der belebten Materie, den Lebewesen. Sie ist ein Teilgebiet der Naturwissenschaften und befasst sich sowohl mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen als auch mit den Besonderheiten der einzelnen Lebewesen: zum Beispiel mit ihrer Entwicklung, ihrem Bauplan und den physikalischen und biochemischen Vorgängen in ihrem Inneren. Im Fach Biologie wird in zahlreichen Teilgebieten geforscht. Zu den ganz allgemein auf das Verständnis des Lebendigen ausgerichteten Teilgebieten gehören insbesondere Biophysik, Genetik, Molekularbiologie, Ökologie, Physiologie, Theoretische Biologie und Zellbiologie. Mit großen Gruppen der Lebewesen befassen sich die Botanik (Pflanzen), die Zoologie (Tiere) und die Mikrobiologie (Kleinstlebewesen und Viren). ⓘ
Die Betrachtungsobjekte der Biologie umfassen u. a. Moleküle, Organellen, Zellen und Zellverbände, Gewebe und Organe, aber auch das Verhalten einzelner Organismen sowie deren Zusammenspiel mit anderen Organismen in ihrer Umwelt. Diese Vielfalt an Betrachtungsobjekten hat zur Folge, dass im Fach Biologie eine Vielfalt an Methoden, Theorien und Modellen angewandt und gelehrt wird. ⓘ
Die Ausbildung von Biologen erfolgt an Universitäten im Rahmen eines Biologiestudiums, von Biologie-Lehramtsstudierenden zumindest zeitweise auch im Rahmen der Biologiedidaktik. ⓘ
In neuerer Zeit haben sich infolge der fließenden Übergänge in andere Wissenschaftsbereiche (z. B. Medizin, Psychologie und Ernährungswissenschaften) sowie wegen des interdisziplinären Charakters der Forschung neben der Bezeichnung Biologie weitere Bezeichnungen für die biologischen Forschungsrichtungen und Ausbildungsgänge etabliert wie zum Beispiel Biowissenschaften, Life Sciences und Lebenswissenschaften. ⓘ
Etymologie
Der Begriff Biologie leitet sich von den altgriechischen Wörtern βίος, romanisiert bíos, mit der Bedeutung "Leben" und -λογία, romanisiert -logía, mit der Bedeutung "Studienrichtung" oder "sprechen" ab. Daraus ergibt sich das griechische Wort βιολογία, romanisiert biología, mit der Bedeutung "Biologie". Trotzdem gab es den Begriff βιολογία als Ganzes im Altgriechischen nicht. Die ersten, die ihn entlehnten, waren die Engländer und Franzosen (biologie). Historisch gab es im Englischen einen anderen Begriff für Biologie, lifelore; er wird heute nur noch selten verwendet. ⓘ
Die lateinische Form des Begriffs erschien erstmals 1736, als der schwedische Wissenschaftler Carl Linnaeus (Carl von Linné) biologi in seiner Bibliotheca Botanica verwendete. Er wurde 1766 in einem Werk mit dem Titel Philosophiae naturalis sive physicae: tomus III, continens geologian, biologian, phytologian generalis von Michael Christoph Hanov, einem Schüler von Christian Wolff, erneut verwendet. Die erste deutsche Verwendung, Biologie, erfolgte 1771 in einer Übersetzung von Linnaeus' Werk. Im Jahr 1797 verwendete Theodor Georg August Roose den Begriff im Vorwort seines Buches Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft. Karl Friedrich Burdach verwendete den Begriff im Jahr 1800 in einem engeren Sinne für das Studium des Menschen aus morphologischer, physiologischer und psychologischer Sicht (Propädeutik zum Studium der gesammelten Heilkunst). Der Begriff fand seine moderne Verwendung mit der sechsbändigen Abhandlung Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur (1802-22) von Gottfried Reinhold Treviranus, der verkündete:
- Gegenstand unserer Forschung sind die verschiedenen Formen und Erscheinungsformen des Lebens, die Bedingungen und Gesetze, unter denen diese Phänomene auftreten, und die Ursachen, durch die sie beeinflusst werden. Die Wissenschaft, die sich mit diesen Gegenständen beschäftigt, werden wir mit dem Namen Biologie oder Lebenslehre bezeichnen.
Viele andere Begriffe, die in der Biologie zur Beschreibung von Pflanzen, Tieren, Krankheiten und Arzneimitteln verwendet werden, stammen aus dem Griechischen und Lateinischen, was auf die historischen Beiträge der griechischen und römischen Zivilisationen der Antike sowie auf die fortgesetzte Verwendung dieser beiden Sprachen an den europäischen Universitäten während des Mittelalters und zu Beginn der Renaissance zurückzuführen ist. ⓘ
Geschichte

Die frühesten Wurzeln der Wissenschaft, zu der auch die Medizin gehörte, lassen sich bis ins alte Ägypten und Mesopotamien zurückverfolgen (etwa 3000 bis 1200 v. Chr.). Ihre Beiträge flossen später in die griechische Naturphilosophie des klassischen Altertums ein und prägten sie. Antike griechische Philosophen wie Aristoteles (384-322 v. Chr.) trugen wesentlich zur Entwicklung des biologischen Wissens bei. Seine Werke, wie z. B. die Geschichte der Tiere, waren besonders wichtig, da sie seine naturalistischen Neigungen offenbaren, und spätere empirischere Werke, die sich auf biologische Ursachen und die Vielfalt des Lebens konzentrierten. Aristoteles' Nachfolger am Lyzeum, Theophrastus, verfasste eine Reihe von Büchern über Botanik, die als wichtigster Beitrag der Antike zu den Pflanzenwissenschaften bis ins Mittelalter hinein erhalten blieben. ⓘ
Zu den Gelehrten der mittelalterlichen islamischen Welt, die über Biologie schrieben, gehörten al-Jahiz (781-869), Al-Dīnawarī (828-896), der über Botanik schrieb, und Rhazes (865-925), der über Anatomie und Physiologie schrieb. Die Medizin wurde von islamischen Gelehrten, die in der Tradition der griechischen Philosophen arbeiteten, besonders gut studiert, während die Naturgeschichte sich stark auf das aristotelische Denken stützte, insbesondere bei der Aufrechterhaltung einer festen Hierarchie des Lebens. ⓘ
Die Biologie begann sich mit Anton van Leeuwenhoeks dramatischer Verbesserung des Mikroskops rasch zu entwickeln und zu wachsen. Damals entdeckten die Gelehrten Spermien, Bakterien, Infusorien und die Vielfalt des mikroskopischen Lebens. Die Untersuchungen von Jan Swammerdam weckten ein neues Interesse an der Entomologie und trugen dazu bei, die grundlegenden Techniken des mikroskopischen Sezierens und Färbens zu entwickeln. ⓘ
Auch die Fortschritte in der Mikroskopie hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das biologische Denken. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wies eine Reihe von Biologen auf die zentrale Bedeutung der Zelle hin. Jahrhundert wiesen mehrere Biologen auf die zentrale Bedeutung der Zelle hin. 1838 begannen Schleiden und Schwann, die inzwischen universellen Ideen zu verbreiten, dass (1) die Zelle die Grundeinheit der Organismen ist und (2) dass einzelne Zellen alle Merkmale des Lebens aufweisen, obwohl sie die Vorstellung ablehnten, dass (3) alle Zellen aus der Teilung anderer Zellen hervorgehen. Robert Remak und Rudolf Virchow gelang es jedoch, den dritten Grundsatz zu verifizieren, und in den 1860er Jahren akzeptierten die meisten Biologen alle drei Grundsätze, die sich zur Zelltheorie verdichteten. ⓘ
In der Zwischenzeit rückten Taxonomie und Klassifizierung in den Fokus der Naturhistoriker. Carl Linnaeus veröffentlichte 1735 eine grundlegende Taxonomie für die natürliche Welt (die seither in verschiedenen Varianten verwendet wird) und führte in den 1750er Jahren wissenschaftliche Namen für alle seine Arten ein. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, betrachtete Arten als künstliche Kategorien und lebende Formen als formbar - er schlug sogar die Möglichkeit einer gemeinsamen Abstammung vor. Obwohl er die Evolution ablehnte, ist Buffon eine Schlüsselfigur in der Geschichte des evolutionären Denkens; seine Arbeit beeinflusste die Evolutionstheorien von Lamarck und Darwin. ⓘ

Ernsthaftes evolutionäres Denken hat seinen Ursprung in den Arbeiten von Jean-Baptiste Lamarck, der als erster eine kohärente Evolutionstheorie vorlegte. Er vertrat die Auffassung, dass die Evolution das Ergebnis von Umweltbelastungen ist, die auf die Eigenschaften von Tieren einwirken, d. h. je häufiger und intensiver ein Organ genutzt wird, desto komplexer und effizienter wird es, wodurch sich das Tier an seine Umwelt anpasst. Lamarck glaubte, dass diese erworbenen Eigenschaften dann an die Nachkommen des Tieres weitergegeben werden könnten, die sie weiterentwickeln und perfektionieren würden. Es war jedoch der britische Naturforscher Charles Darwin, der den biogeografischen Ansatz von Humboldt, die uniformitäre Geologie von Lyell, die Schriften von Malthus über das Bevölkerungswachstum sowie seine eigenen morphologischen Kenntnisse und umfangreichen Naturbeobachtungen miteinander verband und eine erfolgreichere Evolutionstheorie auf der Grundlage der natürlichen Auslese entwickelte; ähnliche Überlegungen und Beweise führten Alfred Russel Wallace unabhängig voneinander zu den gleichen Schlussfolgerungen. Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Auslese verbreitete sich rasch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und wurde bald zu einem zentralen Axiom der sich rasch entwickelnden Wissenschaft der Biologie. ⓘ
Die Grundlage der modernen Genetik begann mit der Arbeit von Gregor Mendel, der 1865 seine "Versuche über Pflanzenhybriden" vorstellte, in denen er die Prinzipien der biologischen Vererbung darlegte und die als Basis für die moderne Genetik dienten. Die Bedeutung seiner Arbeit wurde jedoch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannt, als die Evolutionstheorie zu einer einheitlichen Theorie wurde und die moderne Synthese die darwinistische Evolution mit der klassischen Genetik in Einklang brachte. In den 1940er und frühen 1950er Jahren wies eine Reihe von Experimenten von Alfred Hershey und Martha Chase darauf hin, dass die DNA der Bestandteil der Chromosomen ist, der die als Gene bekannt gewordenen merkmalsübertragenden Einheiten enthält. Die Konzentration auf neue Arten von Modellorganismen wie Viren und Bakterien sowie die Entdeckung der doppelhelikalen Struktur der DNA durch James Watson und Francis Crick im Jahr 1953 markierten den Übergang zur Ära der Molekulargenetik. Seit den 1950er Jahren hat sich die Biologie im molekularen Bereich stark erweitert. Der genetische Code wurde von Har Gobind Khorana, Robert W. Holley und Marshall Warren Nirenberg entschlüsselt, nachdem bekannt wurde, dass die DNA Codons enthält. Schließlich wurde 1990 das Humangenomprojekt mit dem Ziel gestartet, das gesamte menschliche Genom zu entschlüsseln. Dieses Projekt wurde im Jahr 2003 im Wesentlichen abgeschlossen, wobei weitere Analysen noch veröffentlicht werden. Das Humangenomprojekt war der erste Schritt in einem globalen Bestreben, das gesammelte Wissen der Biologie in eine funktionelle, molekulare Definition des menschlichen Körpers und der Körper anderer Organismen einfließen zu lassen. ⓘ
Chemische Grundlage
Atome und Moleküle

Alle Organismen bestehen aus Materie, und alle Materie ist aus Elementen zusammengesetzt. Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff sind die vier Elemente, aus denen 96 % aller Organismen bestehen, während Kalzium, Phosphor, Schwefel, Natrium, Chlor und Magnesium die restlichen 3,7 % ausmachen. Verschiedene Elemente können sich zu Verbindungen wie Wasser zusammenschließen, das für das Leben grundlegend ist. Das Leben auf der Erde begann im Wasser und blieb dort für etwa drei Milliarden Jahre, bevor es auf das Land überging. Materie kann in verschiedenen Zuständen als Feststoff, Flüssigkeit oder Gas vorliegen. ⓘ
Die kleinste Einheit eines Elements ist ein Atom, das aus einem Atomkern und einem oder mehreren Elektronen besteht, die sich um den Kern herum bewegen, wie es das Bohrsche Modell beschreibt. Der Kern besteht aus einem oder mehreren Protonen und einer Anzahl von Neutronen. Protonen haben eine positive elektrische Ladung, Neutronen sind elektrisch neutral, und Elektronen haben eine negative elektrische Ladung. Atome mit gleicher Anzahl von Protonen und Elektronen sind elektrisch neutral. Das Atom eines jeden Elements enthält eine bestimmte Anzahl von Protonen, die als Ordnungszahl bezeichnet wird, und die Summe der Protonen und Neutronen ergibt die Masse des Atoms. Die Massen der einzelnen Protonen, Neutronen und Elektronen können in Gramm oder Dalton (Da) gemessen werden, wobei die Masse eines jeden Protons oder Neutrons auf 1 Da gerundet wird. Obwohl alle Atome eines bestimmten Elements die gleiche Anzahl von Protonen haben, können sie sich in der Anzahl der Neutronen unterscheiden, wodurch sie als Isotope existieren. Kohlenstoff zum Beispiel kann als stabiles Isotop (Kohlenstoff-12 oder Kohlenstoff-13) oder als radioaktives Isotop (Kohlenstoff-14) vorliegen, wobei letzteres bei der radiometrischen Datierung (insbesondere der Radiokohlenstoffdatierung) zur Bestimmung des Alters organischer Materialien verwendet werden kann. ⓘ
Einzelne Atome können durch chemische Bindungen zusammengehalten werden, um Moleküle und ionische Verbindungen zu bilden. Zu den gebräuchlichen Arten von chemischen Bindungen gehören Ionenbindungen, kovalente Bindungen und Wasserstoffbrückenbindungen. Bei der Ionenbindung handelt es sich um die elektrostatische Anziehungskraft zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen oder zwischen zwei Atomen mit stark unterschiedlicher Elektronegativität; sie ist die wichtigste Wechselwirkung in ionischen Verbindungen. Ionen sind Atome (oder Gruppen von Atomen) mit einer elektrostatischen Ladung. Atome, die Elektronen aufnehmen, bilden negativ geladene Ionen (Anionen genannt), während Atome, die Elektronen abgeben, positiv geladene Ionen (Kationen genannt) bilden. ⓘ
Im Gegensatz zu Ionenbindungen werden bei einer kovalenten Bindung Elektronenpaare zwischen den Atomen ausgetauscht. Diese Elektronenpaare und das stabile Gleichgewicht zwischen anziehenden und abstoßenden Kräften zwischen Atomen, wenn sie Elektronen teilen, werden als kovalente Bindung bezeichnet. ⓘ
Eine Wasserstoffbindung ist in erster Linie eine elektrostatische Anziehungskraft zwischen einem Wasserstoffatom, das kovalent an ein elektronegativeres Atom oder eine elektronegative Gruppe wie Sauerstoff gebunden ist. Ein allgegenwärtiges Beispiel für eine Wasserstoffbrückenbindung findet sich zwischen Wassermolekülen. In einem einzelnen Wassermolekül befinden sich zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Zwei Wassermoleküle können untereinander eine Wasserstoffbrücke bilden. Wenn mehr Moleküle vorhanden sind, wie es bei flüssigem Wasser der Fall ist, sind mehr Bindungen möglich, da der Sauerstoff eines Wassermoleküls zwei einsame Elektronenpaare besitzt, von denen jedes eine Wasserstoffbindung mit einem Wasserstoff eines anderen Wassermoleküls eingehen kann. ⓘ
Wasser

Das Leben entstand aus dem ersten Ozean der Erde, der sich vor etwa 3,8 Milliarden Jahren bildete. Seitdem ist Wasser das am häufigsten vorkommende Molekül in jedem Organismus. Wasser ist für das Leben wichtig, weil es ein wirksames Lösungsmittel ist, das in der Lage ist, gelöste Stoffe wie Natrium- und Chloridionen oder andere kleine Moleküle zu lösen und eine wässrige Lösung zu bilden. Einmal im Wasser gelöst, kommen diese gelösten Stoffe eher miteinander in Kontakt und nehmen so an den chemischen Reaktionen teil, die das Leben erhalten. ⓘ
Von seiner molekularen Struktur her ist Wasser ein kleines polares Molekül mit einer gekrümmten Form, die durch die polaren kovalenten Bindungen von zwei Wasserstoffatomen (H) mit einem Sauerstoffatom (O) gebildet wird (H2O). Da die O-H-Bindungen polar sind, ist das Sauerstoffatom leicht negativ geladen und die beiden Wasserstoffatome sind leicht positiv geladen. Diese polare Eigenschaft des Wassers ermöglicht es ihm, andere Wassermoleküle über Wasserstoffbrücken anzuziehen, wodurch das Wasser kohäsiv wird. Die Oberflächenspannung resultiert aus der Kohäsionskraft, die durch die Anziehung zwischen den Molekülen an der Oberfläche der Flüssigkeit entsteht. Wasser ist auch adhäsiv, da es in der Lage ist, an der Oberfläche von polaren oder geladenen Nicht-Wassermolekülen zu haften. ⓘ
Wasser ist in flüssigem Zustand dichter als in festem Zustand (oder Eis). Diese einzigartige Eigenschaft des Wassers ermöglicht es dem Eis, über flüssigem Wasser wie Teichen, Seen und Ozeanen zu schwimmen und so die Flüssigkeit darunter von der kalten Luft darüber zu isolieren. Die geringere Dichte von Eis im Vergleich zu flüssigem Wasser ist auf die geringere Anzahl von Wassermolekülen zurückzuführen, die die Kristallgitterstruktur von Eis bilden, die einen großen Raum zwischen den Wassermolekülen lässt. Im Gegensatz dazu gibt es im flüssigen Wasser keine Kristallgitterstruktur, so dass mehr Wassermoleküle das gleiche Volumen einnehmen können. ⓘ
Wasser hat auch die Fähigkeit, Energie zu absorbieren, was ihm eine höhere spezifische Wärmekapazität verleiht als anderen Lösungsmitteln wie Ethanol. Daher ist eine große Menge an Energie erforderlich, um die Wasserstoffbrücken zwischen den Wassermolekülen aufzubrechen und flüssiges Wasser in Gas (oder Wasserdampf) umzuwandeln. ⓘ
Als Molekül ist Wasser nicht völlig stabil, da jedes Wassermolekül kontinuierlich in Wasserstoff- und Hydroxylionen dissoziiert, bevor es sich wieder zu einem Wassermolekül formiert. In reinem Wasser hält sich die Zahl der Wasserstoffionen mit der Zahl der Hydroxylionen die Waage (oder ist gleich groß), so dass der pH-Wert neutral ist. Übersteigt die Zahl der Wasserstoffionen die der Hydroxylionen, ist der pH-Wert der Lösung sauer. Umgekehrt würde der pH-Wert einer Lösung basisch werden, wenn die Hydroxylionen die Wasserstoffionen übersteigen. ⓘ
Organische Verbindungen

Organische Verbindungen sind Moleküle, die Kohlenstoff in Verbindung mit einem anderen Element, z. B. Wasserstoff, enthalten. Mit Ausnahme von Wasser enthalten fast alle Moleküle, aus denen jeder Organismus besteht, Kohlenstoff. Kohlenstoff hat sechs Elektronen, von denen sich zwei in seiner ersten Schale befinden, so dass vier Elektronen in seiner Valenzschale verbleiben. Daher kann Kohlenstoff kovalente Bindungen mit bis zu vier anderen Atomen eingehen, was ihn zum vielseitigsten Atom der Erde macht, da er in der Lage ist, vielfältige, große und komplexe Moleküle zu bilden. Ein einzelnes Kohlenstoffatom kann zum Beispiel vier einfache kovalente Bindungen wie in Methan, zwei doppelte kovalente Bindungen wie in Kohlendioxid (CO2) oder eine dreifache kovalente Bindung wie in Kohlenmonoxid (CO) eingehen. Darüber hinaus kann Kohlenstoff sehr lange Ketten aus miteinander verbundenen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen bilden, wie z. B. in Oktan, oder ringförmige Strukturen wie in Glukose. ⓘ
Die einfachste Form eines organischen Moleküls ist der Kohlenwasserstoff, eine große Familie von organischen Verbindungen, die aus Wasserstoffatomen bestehen, die an eine Kette von Kohlenstoffatomen gebunden sind. Ein Kohlenwasserstoff-Grundgerüst kann durch andere Elemente wie Sauerstoff (O), Wasserstoff (H), Phosphor (P) und Schwefel (S) ersetzt werden, was das chemische Verhalten der Verbindung verändern kann. Gruppen von Atomen, die diese Elemente (O-, H-, P- und S-) enthalten und an ein zentrales Kohlenstoffatom oder Gerüst gebunden sind, werden als funktionelle Gruppen bezeichnet. Es gibt sechs wichtige funktionelle Gruppen, die in Organismen zu finden sind: Aminogruppe, Carboxylgruppe, Carbonylgruppe, Hydroxylgruppe, Phosphatgruppe und Sulfhydrylgruppe. ⓘ
Im Jahr 1953 führten Stanley Miller und Harold Urey ein klassisches Experiment durch (auch bekannt als Miller-Urey-Experiment), das zeigte, dass organische Verbindungen abiotisch in einem geschlossenen System synthetisiert werden konnten, das die Bedingungen der frühen Erde nachahmte, was sie zu dem Schluss brachte, dass komplexe organische Moleküle spontan in der frühen Erde entstanden sein könnten, höchstwahrscheinlich in der Nähe von Vulkanen, und Teil der frühen Stadien der Abiogenese (oder des Ursprungs des Lebens) sein könnten. ⓘ
Makromoleküle

Makromoleküle sind große Moleküle, die aus kleineren molekularen Untereinheiten bestehen, die miteinander verbunden sind. Kleine Moleküle wie Zucker, Aminosäuren und Nukleotide können als einzelne sich wiederholende Einheiten, die Monomere genannt werden, durch einen chemischen Prozess, der als Kondensation bezeichnet wird, kettenartige Moleküle bilden, die Polymere genannt werden. Aminosäuren können zum Beispiel Polypeptide bilden, während Nukleotide Nukleinsäurestränge bilden können. Polymere bilden drei der vier Makromoleküle (Polysaccharide, Lipide, Proteine und Nukleinsäuren), die in allen Organismen vorkommen. Jedes dieser Makromoleküle spielt in einer bestimmten Zelle eine besondere Rolle. ⓘ
Kohlenhydrate (oder Zucker) sind Moleküle mit der Molekularformel (CH2O)n, wobei n die Anzahl der Kohlenstoff-Hydrat-Gruppen angibt. Sie umfassen Monosaccharide (Monomer), Oligosaccharide (kleine Polymere) und Polysaccharide (große Polymere). Monosaccharide können durch glykosidische Bindungen, eine Art kovalente Bindung, miteinander verbunden sein. Wenn zwei Monosaccharide wie Glucose und Fructose miteinander verbunden sind, können sie ein Disaccharid wie Saccharose bilden. Wenn viele Monosaccharide miteinander verbunden sind, können sie ein Oligosaccharid oder ein Polysaccharid bilden, je nach Anzahl der Monosaccharide. Polysaccharide können unterschiedliche Funktionen haben. Monosaccharide wie Glukose können eine Energiequelle sein, und einige Polysaccharide können als Speichermaterial dienen, das hydrolysiert werden kann, um Zellen mit Zucker zu versorgen. ⓘ
Lipide sind die einzige Klasse von Makromolekülen, die nicht aus Polymeren bestehen. Die biologisch wichtigsten Lipide sind Steroide, Phospholipide und Fette. Diese Lipide sind organische Verbindungen, die weitgehend unpolar und hydrophob sind. Steroide sind organische Verbindungen, die aus vier verschmolzenen Ringen bestehen. Phospholipide bestehen aus Glycerin, das mit einer Phosphatgruppe und zwei Kohlenwasserstoffketten (oder Fettsäuren) verbunden ist. Das Glycerin und die Phosphatgruppe bilden zusammen den polaren und hydrophilen (oder Kopf-) Bereich des Moleküls, während die Fettsäuren den unpolaren und hydrophoben (oder Schwanz-) Bereich bilden. In Wasser neigen Phospholipide daher dazu, eine Phospholipid-Doppelschicht zu bilden, wobei die hydrophoben Köpfe nach außen zeigen, um mit Wassermolekülen in Wechselwirkung zu treten. Umgekehrt sind die hydrophoben Schwänze nach innen zu anderen hydrophoben Schwänzen gerichtet, um den Kontakt mit Wasser zu vermeiden. ⓘ
Proteine sind die vielfältigsten Makromoleküle, zu denen Enzyme, Transportproteine, große Signalmoleküle, Antikörper und Strukturproteine gehören. Die Grundeinheit (oder das Monomer) eines Proteins ist eine Aminosäure, die ein zentrales Kohlenstoffatom hat, das kovalent an ein Wasserstoffatom, eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe und eine Seitenkette (oder R-Gruppe, "R" für Rest) gebunden ist. Es gibt zwanzig Aminosäuren, die die Bausteine der Proteine bilden, wobei jede Aminosäure ihre eigene einzigartige Seitenkette hat. Die Polarität und die Ladung der Seitenketten beeinflussen die Löslichkeit der Aminosäuren. Eine Aminosäure mit einer Seitenkette, die polar und elektrisch geladen ist, ist löslich, da sie hydrophil ist, wohingegen eine Aminosäure mit einer Seitenkette, der ein geladenes oder elektronegatives Atom fehlt, hydrophob ist und daher dazu neigt, in Wasser zu verschmelzen, anstatt sich aufzulösen. Proteine haben vier verschiedene Organisationsebenen (primär, sekundär, tertiär und quartär). Die Primärstruktur besteht aus einer einzigartigen Abfolge von Aminosäuren, die durch Peptidbindungen kovalent miteinander verbunden sind. Die Seitenketten der einzelnen Aminosäuren können dann miteinander interagieren, wodurch die Sekundärstruktur eines Proteins entsteht. Die beiden häufigsten Arten von Sekundärstrukturen sind Alpha-Helices und Beta-Sheets. Durch die Faltung von Alpha-Helices und Beta-Folien erhält ein Protein seine dreidimensionale oder Tertiärstruktur. Schließlich können sich mehrere Tertiärstrukturen miteinander verbinden und die Quartärstruktur eines Proteins bilden. ⓘ
Nukleinsäuren sind Polymere, die aus Monomeren, den Nukleotiden, bestehen. Ihre Aufgabe ist es, Erbinformationen zu speichern, zu übertragen und auszudrücken. Nukleotide bestehen aus einer Phosphatgruppe, einem Fünf-Kohlenstoff-Zucker und einer Stickstoffbase. Ribonukleotide, die Ribose als Zucker enthalten, sind die Monomere der Ribonukleinsäure (RNA). Im Gegensatz dazu enthalten Desoxyribonukleotide Desoxyribose als Zucker und bilden die Monomere der Desoxyribonukleinsäure (DNA). RNA und DNA unterscheiden sich auch hinsichtlich einer ihrer Basen. Es gibt zwei Arten von Basen: Purine und Pyrimidine. Zu den Purinen gehören Guanin (G) und Adenin (A), während die Pyrimidine aus Cytosin (C), Uracil (U) und Thymin (T) bestehen. Uracil wird in der RNA verwendet, während Thymin in der DNA verwendet wird. Wenn man die verschiedenen Zucker und Basen berücksichtigt, gibt es insgesamt acht verschiedene Nukleotide, die zwei Arten von Nukleinsäuren bilden können: DNA (A, G, C und T) und RNA (A, G, C und U). ⓘ
Zellen
Zellen sind grundlegende strukturelle und funktionelle Einheiten von Lebewesen. Man unterscheidet zwischen prokaryotischen Zellen, die keinen Zellkern besitzen und wenig untergliedert sind, und eukaryotischen Zellen, deren Erbinformation sich in einem Zellkern befindet und die verschiedene Zellorganellen enthalten. Zellorganellen sind durch einfache oder doppelte Membranen abgegrenzte Reaktionsräume innerhalb einer Zelle. Sie ermöglichen den gleichzeitigen Ablauf verschiedener, auch entgegengesetzter chemischer Reaktionen. Einen großen Teil der belebten Welt stellen Organismen, die nur aus einer Zelle bestehen, die Einzeller. Sie können dabei aus einer prokaryotischen Zelle bestehen (die Bakterien), oder aus einer eukaryotischen (wie manche Pilze). ⓘ
In mehrzelligen Organismen schließen sich viele Zellen gleicher Bauart und mit gleicher Funktion zu Geweben zusammen. Mehrere Gewebe mit Funktionen, die ineinandergreifen, bilden ein Organ. ⓘ
Biologische Disziplinen, vornehmlich auf dieser Ebene (Beispiele):
- Histologie, Anatomie
- Immunologie, Infektionsbiologie, Neurobiologie
- Mykologie, Mikrobiologie, Protozoologie, Phykologie
- Zellbiologie, Zellphysiologie ⓘ
Aufbau der Zelle

Jede Zelle ist von einer Zellmembran umgeben, die ihr Zytoplasma vom extrazellulären Raum trennt. Eine Zellmembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht, einschließlich Cholesterinen, die zwischen Phospholipiden sitzen, um ihre Flüssigkeit bei verschiedenen Temperaturen zu erhalten. Zellmembranen sind halbdurchlässig und lassen kleine Moleküle wie Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasser durch, während sie die Bewegung größerer Moleküle und geladener Teilchen wie Ionen einschränken. Zellmembranen enthalten auch Membranproteine, darunter integrale Membranproteine, die die Membran durchqueren und als Membrantransporter dienen, und periphere Proteine, die lose an der Außenseite der Zellmembran anhaften und als zellbildende Enzyme wirken. Zellmembranen sind an verschiedenen zellulären Prozessen wie der Zelladhäsion, der Speicherung elektrischer Energie und der Zellsignalisierung beteiligt und dienen als Befestigungsfläche für verschiedene extrazelluläre Strukturen wie Zellwand, Glykokalyx und Zytoskelett. ⓘ

Im Zytoplasma einer Zelle befinden sich zahlreiche Biomoleküle wie Proteine und Nukleinsäuren. Zusätzlich zu den Biomolekülen verfügen eukaryotische Zellen über spezialisierte Strukturen, die Organellen genannt werden und ihre eigenen Lipiddoppelschichten haben oder räumliche Einheiten bilden. Zu diesen Organellen gehören der Zellkern, der den größten Teil der DNA der Zelle enthält, oder die Mitochondrien, die Adenosintriphosphat (ATP) für die Energieversorgung der Zellprozesse erzeugen. Andere Organellen wie das endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat spielen eine Rolle bei der Synthese bzw. Verpackung von Proteinen. Biomoleküle wie Proteine können von Lysosomen, einer weiteren spezialisierten Organelle, verschlungen werden. Pflanzenzellen verfügen über weitere Organellen, die sie von tierischen Zellen unterscheiden, z. B. eine Zellwand, die die Pflanzenzelle stützt, Chloroplasten, die die Energie des Sonnenlichts nutzen, um Zucker zu produzieren, und Vakuolen, die der Lagerung und der strukturellen Unterstützung dienen und auch an der Reproduktion und dem Abbau von Pflanzensamen beteiligt sind. Eukaryontische Zellen verfügen auch über ein Zytoskelett, das aus Mikrotubuli, Intermediärfilamenten und Mikrofilamenten besteht, die allesamt der Zelle Halt geben und an der Bewegung der Zelle und ihrer Organellen beteiligt sind. Die Mikrotubuli bestehen aus Tubulin (z. B. α-Tubulin und β-Tubulin), während die Intermediärfilamente aus faserartigen Proteinen bestehen. Die Mikrofilamente bestehen aus Aktinmolekülen, die mit anderen Proteinsträngen interagieren. ⓘ
Stoffwechsel

Alle Zellen benötigen Energie, um zelluläre Prozesse aufrechtzuerhalten. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, die in der Thermodynamik mithilfe der freien Gibbs-Energie berechnet werden kann. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik bleibt die Energie erhalten, d. h. sie kann weder erzeugt noch zerstört werden. Daher wird bei chemischen Reaktionen in einer Zelle keine neue Energie erzeugt, sondern Energie umgewandelt und übertragen. Dennoch führen alle Energieübertragungen zu einem gewissen Verlust an nutzbarer Energie, was die Entropie (oder den Zustand der Unordnung) erhöht, wie es im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik heißt. Folglich muss einem Organismus kontinuierlich Energie zugeführt werden, um einen niedrigen Entropiezustand aufrechtzuerhalten. In Zellen kann Energie in Form von Elektronen bei Redoxreaktionen (Reduktion-Oxidation) übertragen, in kovalenten Bindungen gespeichert und durch die Bewegung von Ionen (z. B. Wasserstoff, Natrium, Kalium) durch eine Membran erzeugt werden. ⓘ
Der Stoffwechsel ist die Gesamtheit der lebenserhaltenden chemischen Reaktionen in Organismen. Die drei Hauptzwecke des Stoffwechsels sind: die Umwandlung von Nahrung in Energie zur Durchführung zellulärer Prozesse; die Umwandlung von Nahrung/Brennstoff in Bausteine für Proteine, Lipide, Nukleinsäuren und einige Kohlenhydrate; und die Beseitigung von Stoffwechselabfällen. Diese enzymkatalysierten Reaktionen ermöglichen es den Organismen, zu wachsen und sich zu vermehren, ihre Strukturen zu erhalten und auf ihre Umwelt zu reagieren. Stoffwechselreaktionen können als katabolisch - der Abbau von Verbindungen (z. B. der Abbau von Glukose zu Pyruvat durch Zellatmung) - oder anabolisch - der Aufbau (Synthese) von Verbindungen (wie Proteinen, Kohlenhydraten, Lipiden und Nukleinsäuren) - kategorisiert werden. Beim Katabolismus wird in der Regel Energie freigesetzt, während beim Anabolismus Energie verbraucht wird. ⓘ
Die chemischen Reaktionen des Stoffwechsels sind in Stoffwechselwegen organisiert, in denen eine Chemikalie in einer Reihe von Schritten in eine andere Chemikalie umgewandelt wird, wobei jeder Schritt durch ein bestimmtes Enzym erleichtert wird. Enzyme sind für den Stoffwechsel von entscheidender Bedeutung, da sie es den Organismen ermöglichen, erwünschte Reaktionen, die Energie benötigen und nicht von selbst ablaufen, durch Kopplung mit spontanen Reaktionen, die Energie freisetzen, in Gang zu setzen. Enzyme wirken als Katalysatoren, d. h. sie ermöglichen einen schnelleren Ablauf einer Reaktion, ohne dass sie selbst verbraucht wird, indem sie die Aktivierungsenergie verringern, die für die Umwandlung von Reaktanten in Produkte erforderlich ist. Enzyme ermöglichen auch die Regulierung der Geschwindigkeit einer Stoffwechselreaktion, zum Beispiel als Reaktion auf Veränderungen in der Zellumgebung oder auf Signale von anderen Zellen. ⓘ
Zelluläre Atmung

Die Zellatmung ist eine Reihe von Stoffwechselreaktionen und -prozessen, die in den Zellen von Organismen ablaufen, um chemische Energie aus Nährstoffen in Adenosintriphosphat (ATP) umzuwandeln und anschließend Abfallprodukte freizusetzen. Bei den an der Atmung beteiligten Reaktionen handelt es sich um katabole Reaktionen, bei denen große Moleküle unter Freisetzung von Energie in kleinere zerlegt werden. Die Atmung ist einer der wichtigsten Wege, auf denen eine Zelle chemische Energie freisetzt, um die zelluläre Aktivität anzutreiben. Die Gesamtreaktion erfolgt in einer Reihe von biochemischen Schritten, von denen einige Redoxreaktionen sind. Obwohl es sich bei der Zellatmung technisch gesehen um eine Verbrennungsreaktion handelt, ähnelt sie eindeutig nicht einer solchen, wenn sie in einer Zelle abläuft, da die Energie aus der Reihe der Reaktionen langsam und kontrolliert freigesetzt wird. ⓘ
Zucker in Form von Glukose ist der Hauptnährstoff, der von tierischen und pflanzlichen Zellen bei der Atmung verwendet wird. Die Zellatmung unter Beteiligung von Sauerstoff wird als aerobe Atmung bezeichnet, die aus vier Phasen besteht: Glykolyse, Zitronensäurezyklus (oder Krebszyklus), Elektronentransportkette und oxidative Phosphorylierung. Die Glykolyse ist ein Stoffwechselprozess im Zytoplasma, bei dem Glukose in zwei Pyruvate umgewandelt wird, wobei gleichzeitig zwei Nettomoleküle ATP entstehen. Jedes Pyruvat wird dann durch den Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex zu Acetyl-CoA oxidiert, wobei auch NADH und Kohlendioxid entstehen. Acetyl-CoA gelangt in den Zitronensäurezyklus, der innerhalb der Mitochondrienmatrix abläuft. Am Ende des Zyklus werden aus 1 Glukose (oder 2 Pyruvaten) insgesamt 6 NADH, 2 FADH2 und 2 ATP-Moleküle gebildet. Der nächste Schritt ist die oxidative Phosphorylierung, die bei Eukaryonten in den mitochondrialen Cristae stattfindet. Die oxidative Phosphorylierung umfasst die Elektronentransportkette, eine Reihe von vier Proteinkomplexen, die Elektronen von einem Komplex auf einen anderen übertragen und dabei Energie aus NADH und FADH2 freisetzen, die mit dem Pumpen von Protonen (Wasserstoffionen) durch die innere Mitochondrienmembran (Chemiosmose) gekoppelt ist, wodurch eine Protonenmotivkraft entsteht. Die Energie der Protonenmotivkraft treibt das Enzym ATP-Synthase zur Synthese weiterer ATPs durch Phosphorylierung von ADPs an. Die Übertragung von Elektronen endet mit molekularem Sauerstoff als letztem Elektronenakzeptor. ⓘ
Wäre kein Sauerstoff vorhanden, würde Pyruvat nicht durch Zellatmung verstoffwechselt werden, sondern einen Gärungsprozess durchlaufen. Das Pyruvat wird nicht in das Mitochondrium transportiert, sondern verbleibt im Zytoplasma, wo es in Abfallprodukte umgewandelt wird, die aus der Zelle entfernt werden können. Dies dient dem Zweck, die Elektronenträger zu oxidieren, damit sie die Glykolyse wieder durchführen können, und das überschüssige Pyruvat zu entfernen. Bei der Fermentation wird NADH zu NAD+ oxidiert, damit es in der Glykolyse wieder verwendet werden kann. In Abwesenheit von Sauerstoff verhindert die Fermentation die Ansammlung von NADH im Zytoplasma und stellt NAD+ für die Glykolyse bereit. Dieses Abfallprodukt variiert je nach Organismus. In der Skelettmuskulatur ist das Abfallprodukt Milchsäure. Diese Art der Gärung wird als Milchsäuregärung bezeichnet. Bei anstrengender körperlicher Betätigung, wenn der Energiebedarf das Energieangebot übersteigt, kann die Atmungskette nicht alle durch NADH verbundenen Wasserstoffatome verarbeiten. Bei der anaeroben Glykolyse regeneriert sich NAD+, wenn sich Wasserstoffpaare mit Pyruvat zu Laktat verbinden. Die Laktatbildung wird von der Laktatdehydrogenase in einer reversiblen Reaktion katalysiert. Laktat kann auch als indirekte Vorstufe für Leberglykogen verwendet werden. Während der Erholung, wenn Sauerstoff verfügbar wird, verbindet sich NAD+ mit dem Wasserstoff aus Laktat und bildet ATP. In der Hefe sind die Abfallprodukte Ethanol und Kohlendioxid. Diese Art der Gärung wird als alkoholische oder Ethanol-Gärung bezeichnet. Das in diesem Prozess erzeugte ATP wird durch Phosphorylierung auf Substratebene hergestellt, wofür kein Sauerstoff erforderlich ist. ⓘ
Photosynthese

Die Photosynthese ist ein Prozess, der von Pflanzen und anderen Organismen genutzt wird, um Lichtenergie in chemische Energie umzuwandeln, die später freigesetzt werden kann, um die Stoffwechselaktivitäten des Organismus durch Zellatmung anzutreiben. Diese chemische Energie wird in Kohlenhydratmolekülen, wie z. B. Zucker, gespeichert, die aus Kohlendioxid und Wasser synthetisiert werden. In den meisten Fällen wird auch Sauerstoff als Abfallprodukt freigesetzt. Die meisten Pflanzen, Algen und Cyanobakterien betreiben Photosynthese, die weitgehend für die Erzeugung und Aufrechterhaltung des Sauerstoffgehalts der Erdatmosphäre verantwortlich ist und den Großteil der für das Leben auf der Erde erforderlichen Energie liefert. ⓘ
Die Photosynthese besteht aus vier Phasen: Lichtabsorption, Elektronentransport, ATP-Synthese und Kohlenstofffixierung. Die Lichtabsorption ist der erste Schritt der Photosynthese, bei dem die Lichtenergie von den Chlorophyllpigmenten absorbiert wird, die an Proteine in den Thylakoidmembranen gebunden sind. Die absorbierte Lichtenergie wird genutzt, um Elektronen von einem Donor (Wasser) zu einem primären Elektronenakzeptor, einem Chinon mit der Bezeichnung Q, zu transportieren. In der zweiten Stufe wandern die Elektronen vom primären Elektronenakzeptor Chinon durch eine Reihe von Elektronenträgern, bis sie einen endgültigen Elektronenakzeptor erreichen, bei dem es sich in der Regel um die oxidierte Form von NADP+ handelt, das zu NADPH reduziert wird, ein Prozess, der in einem Proteinkomplex namens Photosystem I (PSI) stattfindet. Der Elektronentransport ist an die Bewegung von Protonen (oder Wasserstoff) vom Stroma zur Thylakoidmembran gekoppelt, die einen pH-Gradienten durch die Membran bildet, da der Wasserstoff im Lumen stärker konzentriert ist als im Stroma. Dies ist vergleichbar mit der protonenmotorischen Kraft, die bei der aeroben Atmung durch die innere Mitochondrienmembran erzeugt wird. ⓘ
Während der dritten Stufe der Photosynthese ist die Bewegung der Protonen entlang ihres Konzentrationsgradienten vom Thylakoidlumen zum Stroma durch die ATP-Synthase mit der Synthese von ATP durch dieselbe ATP-Synthase gekoppelt. Das NADPH und das ATP, die durch die lichtabhängigen Reaktionen in der zweiten bzw. dritten Stufe erzeugt werden, liefern die Energie und die Elektronen, um die Synthese von Glukose voranzutreiben, indem atmosphärisches Kohlendioxid in vorhandene organische Kohlenstoffverbindungen wie Ribulosebisphosphat (RuBP) in einer Abfolge von lichtunabhängigen (oder dunklen) Reaktionen, dem so genannten Calvin-Zyklus, gebunden wird. ⓘ
Zellsignalisierung
Zellkommunikation (oder Signalübertragung) ist die Fähigkeit von Zellen, Signale zu empfangen, zu verarbeiten und an ihre Umgebung und an sich selbst weiterzugeben. Bei den Signalen kann es sich um nicht-chemische Signale wie Licht, elektrische Impulse und Wärme oder um chemische Signale (oder Liganden) handeln, die mit Rezeptoren interagieren, die sich in der Zellmembran einer anderen Zelle oder tief im Inneren einer Zelle befinden können. Es gibt im Allgemeinen vier Arten von chemischen Signalen: autokrine, parakrine, juxtakrine und Hormone. Bei autokrinen Signalen wirkt der Ligand auf dieselbe Zelle, die ihn freisetzt. Tumorzellen zum Beispiel können sich unkontrolliert vermehren, weil sie Signale freisetzen, die ihre eigene Selbstteilung auslösen. Bei der parakrinen Signalübertragung diffundiert der Ligand zu nahe gelegenen Zellen und beeinflusst diese. So setzen beispielsweise Gehirnzellen, die Neuronen genannt werden, Liganden, so genannte Neurotransmitter, frei, die durch einen synaptischen Spalt diffundieren und sich mit einem Rezeptor auf einer benachbarten Zelle wie einer anderen Neuronen- oder Muskelzelle verbinden. Bei der juxtakrinen Signalübertragung besteht ein direkter Kontakt zwischen den signalgebenden und den antwortenden Zellen. Hormone schließlich sind Liganden, die durch das Kreislaufsystem von Tieren oder das Gefäßsystem von Pflanzen wandern, um ihre Zielzellen zu erreichen. Sobald sich ein Ligand an einen Rezeptor bindet, kann er das Verhalten einer anderen Zelle beeinflussen, je nach Art des Rezeptors. So können beispielsweise Neurotransmitter, die an einen inotropen Rezeptor binden, die Erregbarkeit einer Zielzelle verändern. Andere Arten von Rezeptoren sind Proteinkinaserezeptoren (z. B. Rezeptor für das Hormon Insulin) und G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Die Aktivierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren kann Second-Messenger-Kaskaden in Gang setzen. Der Prozess, bei dem ein chemisches oder physikalisches Signal als eine Reihe von molekularen Ereignissen durch eine Zelle übertragen wird, wird als Signaltransduktion bezeichnet ⓘ
Zellzyklus

Der Zellzyklus ist eine Reihe von Ereignissen, die in einer Zelle stattfinden und die dazu führen, dass sie sich in zwei Tochterzellen teilt. Zu diesen Ereignissen gehören die Verdopplung der DNA und einiger Organellen sowie die anschließende Aufteilung des Zytoplasmas in zwei Tochterzellen in einem Prozess, der Zellteilung genannt wird. Bei Eukaryoten (d. h. Tier-, Pflanzen-, Pilz- und Protistenzellen) gibt es zwei verschiedene Arten der Zellteilung: Mitose und Meiose. Die Mitose ist ein Teil des Zellzyklus, bei dem die replizierten Chromosomen in zwei neue Zellkerne getrennt werden. Bei der Zellteilung entstehen genetisch identische Zellen, bei denen die Gesamtzahl der Chromosomen erhalten bleibt. Der Mitose (Teilung des Zellkerns) geht im Allgemeinen die S-Phase der Interphase voraus (in der die DNA repliziert wird), auf die häufig die Telophase und die Zytokinese folgen, bei der das Zytoplasma, die Organellen und die Zellmembran einer Zelle in zwei neue Zellen geteilt werden, die etwa gleiche Anteile dieser Zellbestandteile enthalten. Die verschiedenen Stadien der Mitose definieren zusammen die mitotische Phase des tierischen Zellzyklus - die Teilung der Mutterzelle in zwei genetisch identische Tochterzellen. Der Zellzyklus ist ein lebenswichtiger Prozess, durch den sich eine befruchtete Eizelle zu einem reifen Organismus entwickelt, sowie der Prozess, durch den Haare, Haut, Blutzellen und einige innere Organe erneuert werden. Nach der Zellteilung beginnt jede der Tochterzellen die Interphase eines neuen Zyklus. Im Gegensatz zur Mitose entstehen bei der Meiose vier haploide Tochterzellen, indem eine Runde der DNA-Replikation gefolgt von zwei Teilungen durchgeführt wird. Bei der ersten Teilung (Meiose I) werden homologe Chromosomen getrennt, bei der zweiten Teilung (Meiose II) werden Schwesterchromatiden getrennt. Beide Zellteilungszyklen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenszyklus zur sexuellen Fortpflanzung genutzt. Es wird angenommen, dass beide Zyklen bereits beim letzten gemeinsamen Vorfahren der Eukaryoten vorhanden waren. ⓘ
Prokaryoten (d. h. Archaeen und Bakterien) können ebenfalls eine Zellteilung (oder binäre Spaltung) durchführen. Im Gegensatz zu den Prozessen der Mitose und Meiose bei Eukaryonten findet die binäre Spaltung bei Prokaryonten ohne die Bildung eines Spindelapparats an der Zelle statt. Vor der Binärspaltung ist die DNA im Bakterium straff aufgerollt. Nachdem sie sich entrollt und vervielfältigt hat, wird sie zu den getrennten Polen des Bakteriums gezogen, während es sich vergrößert, um sich auf die Spaltung vorzubereiten. Das Wachstum einer neuen Zellwand beginnt, um das Bakterium zu trennen (ausgelöst durch FtsZ-Polymerisation und "Z-Ring"-Bildung). Die neue Zellwand (Septum) entwickelt sich vollständig, was zur vollständigen Teilung des Bakteriums führt. Die neuen Tochterzellen verfügen über straff gewickelte DNA-Stäbchen, Ribosomen und Plasmide. ⓘ
Genetik
Vererbung

Die Genetik ist die wissenschaftliche Untersuchung der Vererbung. Die Mendelsche Vererbung ist der Prozess, durch den Gene und Merkmale von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden. Sie wurde von Gregor Mendel auf der Grundlage seiner Arbeit mit Erbsenpflanzen in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts formuliert. Mendel stellte mehrere Grundsätze der Vererbung auf. Das erste besagt, dass genetische Merkmale, die heute Allele genannt werden, diskret sind und alternative Formen haben (z. B. violett vs. weiß oder groß vs. klein), die jeweils von einem der beiden Elternteile vererbt werden. Auf der Grundlage seines Gesetzes der Dominanz und Uniformität, das besagt, dass einige Allele dominant und andere rezessiv sind, wird ein Organismus mit mindestens einem dominanten Allel den Phänotyp dieses dominanten Allels aufweisen. Ausnahmen von dieser Regel sind Penetranz und Expressivität. Mendel stellte fest, dass sich bei der Bildung der Gameten die Allele für jedes Gen voneinander trennen, so dass jede Gamete nur ein Allel für jedes Gen trägt, was in seinem Segregationsgesetz zum Ausdruck kommt. Heterozygote Individuen produzieren Keimzellen mit einer gleichen Häufigkeit von zwei Allelen. Schließlich formulierte Mendel das Gesetz der unabhängigen Selektion, das besagt, dass die Gene verschiedener Merkmale bei der Bildung der Gameten unabhängig voneinander segregieren können, d. h. die Gene sind nicht miteinander verknüpft. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden Merkmale, die geschlechtsgebunden sind. Um den zugrunde liegenden Genotyp eines Organismus mit einem dominanten Phänotyp experimentell zu bestimmen, können Testkreuzungen durchgeführt werden. Ein Punnett-Quadrat kann verwendet werden, um die Ergebnisse einer Testkreuzung vorherzusagen. Die Chromosomentheorie der Vererbung, die besagt, dass die Gene auf den Chromosomen zu finden sind, wurde durch die Experimente von Thomas Morgans mit Fruchtfliegen gestützt, bei denen die Verbindung zwischen Augenfarbe und Geschlecht bei diesen Insekten nachgewiesen wurde. Bei Menschen und anderen Säugetieren (z. B. Hunden) ist die Durchführung von Testkreuzungsexperimenten weder machbar noch praktisch. Stattdessen werden Stammbäume, also genetische Darstellungen von Stammbäumen, verwendet, um die Vererbung eines bestimmten Merkmals oder einer Krankheit über mehrere Generationen hinweg zu verfolgen. ⓘ
DNA

Ein Gen ist eine Einheit der Vererbung, die einer Region der Desoxyribonukleinsäure (DNS) entspricht, die genetische Informationen trägt, die die Form oder Funktion eines Organismus auf bestimmte Weise beeinflussen. Die DNS ist ein Molekül, das aus zwei Polynukleotidketten besteht, die sich umeinander winden und so eine Doppelhelix bilden, die erstmals 1953 von James Watson und Francis Crick beschrieben wurde. Bei Eukaryonten liegt es in Form von linearen Chromosomen vor, bei Prokaryonten in Form von zirkulären Chromosomen. Ein Chromosom ist eine organisierte Struktur, die aus DNA und Histonen besteht. Der Chromosomensatz einer Zelle und alle anderen Erbinformationen, die sich in den Mitochondrien, den Chloroplasten oder an anderen Stellen befinden, werden zusammen als Genom einer Zelle bezeichnet. Bei Eukaryoten befindet sich die genomische DNA im Zellkern oder in geringen Mengen in Mitochondrien und Chloroplasten. Bei Prokaryonten befindet sich die DNA in einem unregelmäßig geformten Körper im Zytoplasma, dem Nukleoid. Die genetische Information in einem Genom ist in den Genen enthalten, und die vollständige Zusammenstellung dieser Information in einem Organismus wird als Genotyp bezeichnet. Gene kodieren die Informationen, die von den Zellen für die Synthese von Proteinen benötigt werden, die ihrerseits eine zentrale Rolle bei der Beeinflussung des endgültigen Phänotyps des Organismus spielen. ⓘ
Die beiden Polynukleotidstränge, aus denen die DNA besteht, verlaufen in entgegengesetzter Richtung zueinander und sind somit antiparallel. Jeder Strang besteht aus Nukleotiden, wobei jedes Nukleotid eine von vier stickstoffhaltigen Basen (Cytosin [C], Guanin [G], Adenin [A] oder Thymin [T]), einen Zucker namens Desoxyribose und eine Phosphatgruppe enthält. Die Nukleotide sind durch kovalente Bindungen zwischen dem Zucker eines Nukleotids und dem Phosphat des nächsten Nukleotids zu einer Kette verbunden, die ein abwechselndes Zucker-Phosphat-Grundgerüst bildet. Die Abfolge dieser vier Basen entlang des Rückgrats kodiert die genetische Information. Die Basen der beiden Polynukleotidstränge sind durch Wasserstoffbrückenbindungen nach den Regeln der Basenpaarung (A mit T und C mit G) miteinander verbunden, so dass eine doppelsträngige DNA entsteht. Die Basen werden in zwei Gruppen unterteilt: Pyrimidine und Purine. In der DNA sind die Pyrimidine Thymin und Cytosin, die Purine sind Adenin und Guanin. ⓘ
Aufgrund des ungleichmäßigen Abstands der DNA-Stränge zueinander gibt es Furchen, die über die gesamte Länge der Doppelhelix verlaufen. Beide Furchen sind unterschiedlich groß, wobei die Hauptfurche größer und damit für die Bindung von Proteinen besser zugänglich ist als die Nebenfurche. Die Außenkanten der Basen liegen in diesen Furchen frei und sind daher für zusätzliche Wasserstoffbrückenbindungen zugänglich. Da jede Furche zwei mögliche Basenpaar-Konfigurationen aufweisen kann (G-C und A-T), gibt es innerhalb der gesamten Doppelhelix vier mögliche Basenpaar-Konfigurationen, die sich chemisch voneinander unterscheiden. Infolgedessen können Proteinmoleküle spezifische Basenpaar-Sequenzen erkennen und an sie binden, was die Grundlage für spezifische DNA-Protein-Wechselwirkungen bildet. ⓘ
Die DNA-Replikation ist ein semikonservativer Prozess, bei dem jeder Strang als Vorlage für einen neuen DNA-Strang dient. Der Prozess beginnt mit der Aufspaltung der Doppelhelix an einem Replikationsursprung, der die beiden Stränge trennt und sie so als zwei Vorlagen verfügbar macht. Anschließend bindet das Enzym Primase an die Matrize, um einen RNA-Startstrang (oder DNA bei einigen Viren), den so genannten Primer, von der 5'- bis zur 3'-Position zu synthetisieren. Sobald der Primer fertiggestellt ist, wird die Primase von der Matrize freigesetzt, woraufhin das Enzym DNA-Polymerase an dieselbe Matrize bindet, um neue DNA zu synthetisieren. Die Geschwindigkeit der DNA-Replikation in einer lebenden Zelle wurde mit 749 hinzugefügten Nukleotiden pro Sekunde unter idealen Bedingungen gemessen. ⓘ
Die DNA-Replikation ist nicht perfekt, da die DNA-Polymerase manchmal Basen einfügt, die nicht komplementär zur Vorlage sind (z. B. A in den Strang gegenüber von G im Vorlagenstrang). Bei Eukaryoten liegt die anfängliche Fehler- oder Mutationsrate bei etwa 1 zu 100.000. Korrekturlesen und Mismatch-Reparatur sind die beiden Mechanismen, die diese Fehler reparieren, wodurch die Mutationsrate auf 10-10 sinkt, insbesondere vor und nach einem Zellzyklus. ⓘ
Mutationen sind vererbbare Veränderungen in der DNA. Sie können spontan als Folge von Replikationsfehlern entstehen, die nicht durch Korrekturlesen korrigiert wurden, oder durch Umweltmutagene wie Chemikalien (z. B. salpetrige Säure, Benzopyren) oder Strahlung (z. B. Röntgen-, Gammastrahlen, ultraviolette Strahlung, von instabilen Isotopen emittierte Teilchen) ausgelöst werden. Mutationen können als Veränderung einer einzelnen Base oder in größerem Umfang als Chromosomenmutationen wie Deletionen, Inversionen oder Translokationen auftreten. ⓘ
In mehrzelligen Organismen können Mutationen in somatischen oder Keimbahnzellen auftreten. In somatischen Zellen werden die Mutationen während der Mitose an die Tochterzellen weitergegeben. In einer Keimbahnzelle wie einem Spermium oder einer Eizelle tritt die Mutation in einem Organismus bei der Befruchtung auf. Mutationen können zu verschiedenen Arten von phänotypischen Auswirkungen führen, z. B. zu stummen Mutationen, Funktionsverlusten, Funktionsgewinnen und konditionalen Mutationen. ⓘ
Einige Mutationen können nützlich sein, da sie eine Quelle genetischer Variation für die Evolution darstellen. Andere können schädlich sein, wenn sie zu einem Funktionsverlust von Genen führen, die für das Überleben notwendig sind. Mutagene wie Karzinogene werden in der Regel aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspolitik vermieden. Ein Beispiel ist das Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) im Rahmen des Montrealer Protokolls, da FCKW zum Abbau der Ozonschicht führen, wodurch mehr ultraviolette Strahlung der Sonne die obere Erdatmosphäre durchdringt, was somatische Mutationen verursacht, die zu Hautkrebs führen können. In ähnlicher Weise wurden in der ganzen Welt Rauchverbote durchgesetzt, um die Häufigkeit von Lungenkrebs zu verringern. ⓘ
Genexpression

Die Genexpression ist der molekulare Prozess, durch den ein Genotyp zu einem Phänotyp, d. h. einem beobachtbaren Merkmal, führt. Die in der DNA gespeicherte genetische Information stellt den Genotyp dar, während der Phänotyp aus der Synthese von Proteinen resultiert, die die Struktur und Entwicklung eines Organismus steuern oder als Enzyme fungieren, die bestimmte Stoffwechselvorgänge katalysieren. Dieser Prozess wird durch das zentrale Dogma der Molekularbiologie zusammengefasst, das 1958 von Francis Crick formuliert wurde. Dem zentralen Dogma zufolge fließt die genetische Information von der DNA über die RNA zum Protein. Es gibt also zwei Prozesse der Genexpression: Transkription (DNA zu RNA) und Translation (RNA zu Protein). Diese Prozesse werden von allen Lebewesen - Eukaryonten (einschließlich mehrzelliger Organismen), Prokaryonten (Bakterien und Archaeen) - genutzt und von Viren ausgenutzt, um die makromolekulare Maschinerie des Lebens zu erzeugen. ⓘ
Bei der Transkription werden Stränge der Boten-RNA (mRNA) unter Verwendung von DNA-Strängen als Vorlage erstellt, was eingeleitet wird, wenn die RNA-Polymerase an eine DNA-Sequenz, den so genannten Promotor, bindet, der die RNA anweist, mit der Transkription eines der beiden DNA-Stränge zu beginnen. Die DNA-Basen werden gegen die entsprechenden Basen ausgetauscht, außer im Fall von Thymin (T), das die RNA durch Uracil (U) ersetzt. Bei Eukaryoten enthält ein großer Teil der DNA (z. B. >98 % beim Menschen) nicht codierende Introns, die nicht als Muster für Proteinsequenzen dienen. Die kodierenden Regionen oder Exons sind zusammen mit den Introns in das primäre Transkript (oder prä-mRNA) eingestreut. Vor der Translation wird die prä-mRNA einer weiteren Verarbeitung unterzogen, bei der die Introns entfernt (oder herausgespleißt) werden, so dass nur die gespleißten Exons im reifen mRNA-Strang übrig bleiben. ⓘ
Die Übersetzung der mRNA in ein Protein erfolgt in Ribosomen, wobei der transkribierte mRNA-Strang die Sequenz der Aminosäuren in den Proteinen mit Hilfe des genetischen Codes festlegt. Bei den Genprodukten handelt es sich häufig um Proteine, aber bei nicht-proteinkodierenden Genen wie der Transfer-RNA (tRNA) und der kleinen Kern-RNA (snRNA) ist das Produkt eine funktionelle nicht-kodierende RNA. ⓘ
Genregulation
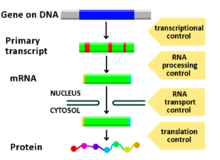
Die Regulierung der Genexpression (oder Genregulation) durch Umweltfaktoren und während verschiedener Entwicklungsstadien kann in jedem Schritt des Prozesses erfolgen, wie z. B. bei der Transkription, dem RNA-Spleißen, der Translation und der posttranslationalen Modifikation eines Proteins. ⓘ
Die Fähigkeit, die Gentranskription zu regulieren, ermöglicht es, Energie zu sparen, da die Zellen nur dann Proteine herstellen, wenn sie benötigt werden. Die Genexpression kann durch positive oder negative Regulierung beeinflusst werden, je nachdem, welche der beiden Arten von Regulierungsproteinen, die Transkriptionsfaktoren genannt werden, an die DNA-Sequenz in der Nähe oder am Promotor binden. Eine Gruppe von Genen, die sich denselben Promotor teilen, wird als Operon bezeichnet und kommt hauptsächlich bei Prokaryoten und einigen niederen Eukaryoten (z. B. Caenorhabditis elegans) vor. Es wurde erstmals in den 1960er Jahren von François Jacob und Jacques Monod in Escherichia coli - einer prokaryontischen Zelle, die im Darm von Menschen und anderen Tieren vorkommt - entdeckt. Sie untersuchten das lac-Operon der prokaryontischen Zelle, das aus drei Genen (lacZ, lacY und lacA) besteht, die für drei laktosemetabolisierende Enzyme (β-Galaktosidase, β-Galaktosid-Permease und β-Galaktosid-Transacetylase) kodieren. Bei der positiven Regulation der Genexpression ist der Aktivator der Transkriptionsfaktor, der die Transkription stimuliert, wenn er an die Sequenz in der Nähe oder am Promotor bindet. Im Gegensatz dazu findet eine negative Regulation statt, wenn ein anderer Transkriptionsfaktor, ein so genannter Repressor, an eine DNA-Sequenz bindet, die als Operator bezeichnet wird und Teil eines Operons ist, um die Transkription zu verhindern. Bindet ein Repressor an ein repressibles Operon (z. B. trp-Operon), so tut er dies nur in Gegenwart eines Corepressors. Repressoren können durch so genannte Induktoren (z. B. Allolaktose) gehemmt werden, die ihre Wirkung dadurch entfalten, dass sie an einen Repressor binden und ihn daran hindern, sich an einen Operator zu binden, so dass die Transkription stattfinden kann. Spezifische Gene, die durch Induktoren aktiviert werden können, werden als induzierbare Gene bezeichnet (z. B. lacZ oder lacA in E. coli), im Gegensatz zu konstitutiven Genen, die fast immer aktiv sind. Im Gegensatz zu beiden kodieren Strukturgene Proteine, die nicht an der Genregulation beteiligt sind. ⓘ
In prokaryontischen Zellen wird die Transkription durch Proteine, so genannte Sigma-Faktoren, reguliert, die an die RNA-Polymerase binden und sie zu bestimmten Promotoren leiten. In ähnlicher Weise können Transkriptionsfaktoren in eukaryontischen Zellen auch die Expression einer Gruppe von Genen koordinieren, selbst wenn die Gene selbst auf verschiedenen Chromosomen liegen. Die Koordinierung dieser Gene kann erfolgen, solange sie dieselbe regulatorische DNA-Sequenz aufweisen, die an dieselben Transkriptionsfaktoren bindet. Promotoren in eukaryotischen Zellen sind vielfältiger, enthalten aber in der Regel eine Kernsequenz, an die sich die RNA-Polymerase binden kann, wobei die häufigste Sequenz die TATA-Box ist, die mehrere sich wiederholende A- und T-Basen enthält. Die RNA-Polymerase II ist die RNA-Polymerase, die an einen Promotor bindet, um die Transkription von proteinkodierenden Genen in Eukaryonten zu initiieren, allerdings nur in Anwesenheit mehrerer allgemeiner Transkriptionsfaktoren, die sich von den Transkriptionsfaktoren mit regulatorischer Wirkung, d. h. Aktivatoren und Repressoren, unterscheiden. In eukaryontischen Zellen werden DNA-Sequenzen, die an Aktivatoren binden, als Enhancer bezeichnet, während Sequenzen, die an Repressoren binden, als Silencer bezeichnet werden. Transkriptionsfaktoren wie der Nuklearfaktor aktivierter T-Zellen (NFAT) sind in der Lage, spezifische Nukleotidsequenzen auf der Grundlage der Basensequenz (z. B. CGAGGAAAATTG für NFAT) der Bindungsstelle zu identifizieren, die die Anordnung der chemischen Gruppen innerhalb dieser Sequenz bestimmt, die spezifische DNA-Protein-Interaktionen ermöglicht. Die Expression von Transkriptionsfaktoren ist die Grundlage für die zelluläre Differenzierung in einem sich entwickelnden Embryo. ⓘ
Neben der Regulierung durch den Promotor kann die Genexpression auch durch epigenetische Veränderungen des Chromatins, eines Komplexes aus DNA und Proteinen, der in eukaryontischen Zellen vorkommt, gesteuert werden. ⓘ
Die posttranskriptionelle Kontrolle der mRNA kann das alternative Spleißen von primären mRNA-Transkripten beinhalten, was dazu führt, dass ein einziges Gen verschiedene reife mRNAs hervorbringt, die für eine Familie verschiedener Proteine kodieren. Ein gut untersuchtes Beispiel ist das Sxl-Gen in Drosophila, das bei diesen Tieren das Geschlecht bestimmt. Das Gen selbst enthält vier Exons, und durch alternatives Spleißen seines prä-mRNA-Transkripts können zwei aktive Formen des Sxl-Proteins bei weiblichen Fliegen und eine inaktive Form des Proteins bei Männchen entstehen. Ein weiteres Beispiel ist das humane Immundefizienzvirus (HIV), das ein einziges prä-mRNA-Transkript besitzt, aus dem durch alternatives Spleißen bis zu neun Proteine entstehen können. Beim Menschen sind achtzig Prozent aller 21.000 Gene alternativ gespleißt. Da Schimpansen und Menschen eine ähnliche Anzahl von Genen haben, wird vermutet, dass das alternative Spleißen zur Komplexität des menschlichen Gehirns beigetragen haben könnte, da es im menschlichen Gehirn mehr alternative Spleißungen gibt als im Gehirn von Schimpansen. ⓘ
Die Translation kann auf drei bekannte Arten reguliert werden. Eine davon ist die Bindung winziger RNA-Moleküle, so genannter microRNA (miRNA), an ein mRNA-Ziel-Transkript, wodurch dessen Translation gehemmt und es abgebaut wird. Die Translation kann auch durch die Veränderung der 5'-Kappe gehemmt werden, indem das modifizierte Guanosintriphosphat (GTP) am 5'-Ende einer mRNA durch ein unmodifiziertes GTP-Molekül ersetzt wird. Schließlich können Translations-Repressorproteine an mRNAs binden und verhindern, dass diese an ein Ribosom gebunden werden, wodurch die Translation blockiert wird. ⓘ
Nach der Translation kann die Stabilität von Proteinen reguliert werden, indem sie gezielt abgebaut werden. Ein gängiges Beispiel ist, dass ein Enzym ein Ubiquitin genanntes Regulierungsprotein an den Lysinrest eines Zielproteins bindet. Andere Ubiquitine werden dann an das primäre Ubiquitin angehängt, um ein polyubiquitiniertes Protein zu bilden, das dann in einen viel größeren Proteinkomplex, das Proteasom, gelangt. Sobald das polyubiquitinierte Protein in das Proteasom eintritt, löst sich das Polyubiquitin vom Zielprotein, das durch das Proteasom ATP-abhängig entfaltet wird, so dass es von drei Proteasen hydrolysiert werden kann. ⓘ
Genome

Ein Genom ist der vollständige DNA-Satz eines Organismus, einschließlich aller seiner Gene. Die Sequenzierung und Analyse von Genomen kann mit Hilfe von Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung und Bioinformatik durchgeführt werden, um die Funktion und Struktur ganzer Genome zusammenzustellen und zu analysieren. Die Genome von Prokaryonten sind klein, kompakt und vielfältig. Im Gegensatz dazu sind die Genome von Eukaryonten größer und komplexer, da sie mehr regulatorische Sequenzen enthalten und ein Großteil ihres Genoms aus nicht codierenden DNA-Sequenzen für funktionelle RNA (rRNA, tRNA und mRNA) oder regulatorischen Sequenzen besteht. Die Genome verschiedener Modellorganismen wie Arabidopsis, Fruchtfliege, Mäuse, Fadenwürmer und Hefe wurden sequenziert. Das Humangenomprojekt war ein Großprojekt der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms, das 2003 abgeschlossen wurde. Die Sequenzierung des menschlichen Genoms hat zu praktischen Anwendungen wie dem DNA-Fingerabdruck geführt, der für Vaterschaftstests und in der Forensik verwendet werden kann. In der Medizin ermöglichte die Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms die Identifizierung von Mutationen, die Tumore verursachen, sowie von Genen, die eine bestimmte genetische Störung verursachen. Die Sequenzierung der Genome verschiedener Organismen hat zur Entstehung der vergleichenden Genomik geführt, die darauf abzielt, die Gene der Genome dieser verschiedenen Organismen zu vergleichen. ⓘ
Viele Gene kodieren mehr als ein Protein, wobei posttranslationale Modifikationen die Vielfalt der Proteine in einer Zelle erhöhen. Das Proteom eines Organismus ist die Gesamtheit der von seinem Genom exprimierten Proteine, und die Proteomik zielt darauf ab, die Gesamtheit der von einem Organismus produzierten Proteine zu untersuchen. Da viele Proteine Enzyme sind, wirkt sich ihre Aktivität auf die Konzentrationen von Substraten und Produkten aus. Wenn sich also das Proteom ändert, ändert sich auch die Menge der kleinen Moleküle oder Metaboliten. Die Gesamtheit der kleinen Moleküle in einer Zelle oder einem Organismus wird als Metabolom bezeichnet, und Metabolomik ist die Untersuchung des Metaboloms im Zusammenhang mit der physiologischen Aktivität einer Zelle oder eines Organismus. ⓘ
In diesem Fachgebiet versuchen Bio-Ingenieure, künstliche lebensfähige Systeme herzustellen, die wie naturgegebene Organismen von einem Genom gesteuert werden. ⓘ
Biotechnologie

Biotechnologie ist die Verwendung von Zellen oder Organismen zur Entwicklung von Produkten für den Menschen. Eine weit verbreitete Technologie ist die Herstellung rekombinanter DNA, d. h. eines DNA-Moleküls, das in einem Labor aus zwei oder mehr Quellen zusammengesetzt wird. Vor der Einführung der Polymerase-Kettenreaktion manipulierten Biologen die DNA, indem sie sie mit Restriktionsenzymen in kleinere Fragmente zerschnitten. Anschließend reinigten und analysierten sie die Fragmente mithilfe der Gelelektrophorese und fügten die Fragmente später mit Hilfe von DNA-Ligase zu einer neuen DNA-Sequenz zusammen. Die rekombinante DNA wird dann geklont, indem sie in eine Wirtszelle eingebracht wird, ein Prozess, der als Transformation bezeichnet wird, wenn es sich bei den Wirtszellen um Bakterien wie E. coli handelt, oder als Transfektion, wenn es sich bei den Wirtszellen um eukaryotische Zellen wie Hefe, Pflanzen oder Tierzellen handelt. Sobald die Wirtszelle oder der Organismus die rekombinante DNA aufgenommen und integriert hat, wird sie als transgen bezeichnet. ⓘ
Eine rekombinante DNA kann auf zwei Arten eingefügt werden. Eine gängige Methode besteht darin, die DNA einfach in ein Wirtschromosom einzufügen, wobei die Einfügestelle zufällig ist. Ein anderer Ansatz besteht darin, die rekombinante DNA als Teil einer anderen DNA-Sequenz, eines so genannten Vektors, einzufügen, der dann in das Wirts-Chromosom integriert wird oder seinen eigenen DNA-Replikationsursprung hat, so dass er sich unabhängig vom Wirts-Chromosom replizieren kann. Plasmide aus Bakterienzellen wie E. coli werden aufgrund ihrer relativ geringen Größe (z. B. 2000-6000 Basenpaare in E. coli), des Vorhandenseins von Restriktionsenzymen, von Genen, die gegen Antibiotika resistent sind, und des Vorhandenseins eines Replikationsursprungs normalerweise als Vektoren verwendet. Ein Gen, das für einen selektierbaren Marker wie die Antibiotikaresistenz kodiert, wird ebenfalls in den Vektor eingebaut. Die Aufnahme dieses Markers ermöglicht es, nur diejenigen Wirtszellen zu selektieren, die die rekombinante DNA enthalten, während diejenigen, die dies nicht tun, aussortiert werden. Außerdem dient der Marker auch als Reportergen, das, sobald es exprimiert wird, leicht nachgewiesen und gemessen werden kann. ⓘ
Sobald sich die rekombinante DNA in einzelnen Bakterienzellen befindet, werden diese Zellen ausplattiert und wachsen zu einer Kolonie, die Millionen von transgenen Zellen enthält, die dieselbe rekombinante DNA tragen. Diese transgenen Zellen produzieren dann große Mengen des transgenen Produkts, wie z. B. Humaninsulin, das als erstes Medikament mit Hilfe der rekombinanten DNA-Technologie hergestellt wurde. ⓘ
Eines der Ziele des molekularen Klonens ist es, die Funktion bestimmter DNA-Sequenzen und der von ihnen kodierten Proteine zu ermitteln. Um eine bestimmte DNA-Sequenz zu untersuchen und zu manipulieren, müssen Millionen von Kopien von DNA-Fragmenten mit dieser DNA-Sequenz hergestellt werden. Dazu muss ein intaktes Genom, das viel zu groß ist, um in eine Wirtszelle eingeführt zu werden, in kleinere DNA-Fragmente zerlegt werden. Auch wenn es nicht mehr intakt ist, bildet die Sammlung dieser DNA-Fragmente immer noch das Genom eines Organismus, wobei die Sammlung selbst als genomische Bibliothek bezeichnet wird, da es möglich ist, bestimmte DNA-Fragmente für weitere Untersuchungen zu suchen und zu entnehmen, ähnlich wie bei der Entnahme eines Buches aus einer normalen Bibliothek. DNA-Fragmente können mit Hilfe von Restriktionsenzymen und anderen Verfahren wie dem mechanischen Scheren gewonnen werden. Jedes gewonnene Fragment wird dann in einen Vektor eingefügt, der von einer bakteriellen Wirtszelle aufgenommen wird. Die Wirtszelle wird dann auf einem selektiven Medium (z. B. Antibiotikaresistenz) vermehrt, wodurch eine Kolonie dieser rekombinanten Zellen entsteht, von denen jede viele Kopien desselben DNA-Fragments enthält. Diese Kolonien können gezüchtet werden, indem man sie auf einem festen Medium in Petrischalen ausbreitet, die bei einer geeigneten Temperatur bebrütet werden. Eine Schale allein kann Tausende von Bakterienkolonien enthalten, die leicht auf eine bestimmte DNA-Sequenz untersucht werden können. Die Sequenz kann identifiziert werden, indem zunächst eine Petrischale mit Bakterienkolonien vervielfältigt und dann die DNA der vervielfältigten Kolonien zur Hybridisierung ausgesetzt wird, wobei sie mit komplementären radioaktiven oder fluoreszierenden Nukleotiden markiert werden. ⓘ
Kleinere DNA-Bibliotheken, die Gene aus einem bestimmten Gewebe enthalten, können mit komplementärer DNA (cDNA) erstellt werden. Die Sammlung dieser cDNAs aus einem bestimmten Gewebe zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als cDNA-Bibliothek bezeichnet, die eine "Momentaufnahme" der Transkriptionsmuster von Zellen an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. ⓘ
Zu den weiteren biotechnologischen Instrumenten gehören DNA-Mikroarrays, Expressionsvektoren, synthetische Genomik und CRISPR-Genbearbeitung. Andere Ansätze wie die Pharmazie können durch den Einsatz genetisch veränderter Organismen große Mengen medizinisch nützlicher Produkte erzeugen. Viele dieser anderen Instrumente finden ebenfalls breite Anwendung, z. B. bei der Herstellung medizinisch nützlicher Proteine oder bei der Verbesserung des Pflanzenanbaus und der Tierhaltung. ⓘ
Gene, Entwicklung und Evolution

Die Entwicklung ist der Prozess, bei dem ein mehrzelliger Organismus (Pflanze oder Tier) eine Reihe von Veränderungen durchläuft, ausgehend von einer einzigen Zelle, und verschiedene Formen annimmt, die für seinen Lebenszyklus charakteristisch sind. Es gibt vier Schlüsselprozesse, die der Entwicklung zugrunde liegen: Determination, Differenzierung, Morphogenese und Wachstum. Die Determination legt das Entwicklungsschicksal einer Zelle fest, das im Laufe der Entwicklung immer mehr eingeschränkt wird. Die Differenzierung ist der Prozess, bei dem sich spezialisierte Zellen aus weniger spezialisierten Zellen, wie z. B. Stammzellen, entwickeln. Stammzellen sind undifferenzierte oder teilweise differenzierte Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen differenzieren und sich unbegrenzt vermehren können, um mehr von derselben Stammzelle zu produzieren. Die zelluläre Differenzierung verändert drastisch die Größe, die Form, das Membranpotenzial, die Stoffwechselaktivität und die Empfindlichkeit einer Zelle gegenüber Signalen, was größtenteils auf stark kontrollierte Veränderungen der Genexpression und Epigenetik zurückzuführen ist. Mit wenigen Ausnahmen geht die zelluläre Differenzierung fast nie mit einer Veränderung der DNA-Sequenz selbst einher. Daher können verschiedene Zellen trotz desselben Genoms sehr unterschiedliche physische Merkmale aufweisen. Die Morphogenese, also die Entwicklung der Körperform, ist das Ergebnis räumlicher Unterschiede in der Genexpression. Insbesondere die Organisation von differenzierten Geweben in spezifische Strukturen wie Arme oder Flügel, die als Musterbildung bekannt ist, wird durch Morphogene gesteuert, Signalmoleküle, die sich von einer Gruppe von Zellen zu den umliegenden Zellen bewegen und einen Morphogengradienten schaffen, wie er im Modell der französischen Flagge beschrieben wird. Apoptose, der programmierte Zelltod, tritt ebenfalls während der Morphogenese auf, wie zum Beispiel das Absterben von Zellen zwischen den Zehen in der menschlichen Embryonalentwicklung, wodurch einzelne Finger und Zehen frei werden. Die Expression von Transkriptionsfaktorgenen kann die Platzierung von Organen in einer Pflanze bestimmen, und eine Kaskade von Transkriptionsfaktoren selbst kann die Körpersegmentierung in einer Fruchtfliege festlegen. ⓘ
Ein kleiner Teil der Gene im Genom eines Organismus, der so genannte entwicklungsgenetische Werkzeugkasten, steuert die Entwicklung dieses Organismus. Diese Toolkit-Gene sind in den verschiedenen Phyla hoch konserviert, d. h. sie sind sehr alt und ähneln sich in weit voneinander entfernten Tiergruppen sehr stark. Unterschiede im Einsatz der Toolkit-Gene wirken sich auf den Körperbau sowie auf die Anzahl, Identität und das Muster der Körperteile aus. Zu den wichtigsten Toolkit-Genen gehören die Hox-Gene. Hox-Gene bestimmen, wo sich wiederholende Teile, wie die vielen Wirbel von Schlangen, in einem sich entwickelnden Embryo oder einer Larve wachsen. Variationen im Werkzeugkasten könnten einen großen Teil der morphologischen Evolution der Tiere bewirkt haben. Das Toolkit kann die Evolution auf zwei Arten vorantreiben. Ein Toolkit-Gen kann in einem anderen Muster exprimiert werden, wie z. B. bei der Vergrößerung des Schnabels von Darwins großem Stieglitz durch das BMP-Gen, oder als Schlangen ihre Beine verloren, weil die Distal-less (Dlx)-Gene an den Stellen, an denen andere Reptilien weiterhin ihre Gliedmaßen ausbildeten, unterexprimiert oder überhaupt nicht mehr exprimiert wurden. Oder ein Toolkit-Gen kann eine neue Funktion erhalten, wie dies bei den vielen Funktionen desselben Gens, Distal-less, zu sehen ist, das so unterschiedliche Strukturen wie den Unterkiefer bei Wirbeltieren, Beine und Fühler bei der Fruchtfliege und das Augenfleckenmuster bei Schmetterlingsflügeln kontrolliert. Da kleine Veränderungen in Toolbox-Genen bedeutende Veränderungen in Körperstrukturen bewirken können, haben sie oft eine konvergente oder parallele Evolution ermöglicht. ⓘ
Entwicklung
Evolutionäre Prozesse

Ein zentrales Konzept der Biologie besagt, dass sich das Leben durch Evolution verändert und weiterentwickelt, d. h. durch die Veränderung der vererbbaren Merkmale von Populationen über mehrere Generationen hinweg. Die Evolution wird heute zur Erklärung der großen Vielfalt des Lebens auf der Erde herangezogen. Der Begriff Evolution wurde 1809 von Jean-Baptiste de Lamarck in das wissenschaftliche Lexikon eingeführt. Er schlug vor, dass die Evolution durch die Vererbung erworbener Merkmale zustande kommt, was zwar nicht überzeugend war, aber es gab damals keine alternativen Erklärungen. Charles Darwin, ein englischer Naturforscher, war 1836 von seiner fünfjährigen Reise auf der HMS Beagle nach England zurückgekehrt, wo er Gesteine studierte und Pflanzen und Tiere aus verschiedenen Teilen der Welt, wie z. B. von den Galápagos-Inseln, sammelte. Außerdem hatte er die Bücher Principles of Geology von Charles Lyell und An Essay on the Principle of Population von Thomas Malthus gelesen und wurde von ihnen beeinflusst. Auf der Grundlage seiner Beobachtungen und Lektüre begann Darwin, seine Theorie der Evolution durch natürliche Selektion zu formulieren, um die Vielfalt der Pflanzen und Tiere in verschiedenen Teilen der Welt zu erklären. Alfred Russel Wallace, ein weiterer englischer Naturforscher, der Pflanzen und Tiere im Malaiischen Archipel studiert hatte, kam ebenfalls zu dieser Idee, allerdings später und unabhängig von Darwin. Sowohl Darwin als auch Wallace präsentierten ihren Aufsatz bzw. ihr Manuskript 1858 gemeinsam vor der Linnaean Society in London und wurden so für ihre Entdeckung der Evolution durch natürliche Selektion geehrt. Darwin veröffentlichte später sein Buch On the Origin of Species (Über die Entstehung der Arten) im Jahr 1859, in dem er detailliert erklärte, wie der Prozess der Evolution durch natürliche Selektion funktioniert. ⓘ
Um die natürliche Auslese zu erklären, zog Darwin eine Analogie zum Menschen, der Tiere durch künstliche Auslese veränderte, wobei Tiere selektiv auf bestimmte Eigenschaften gezüchtet wurden, was zu Individuen führte, die ihren wilden Vorfahren nicht mehr ähnelten. Darwin vertrat die Ansicht, dass in der natürlichen Welt die Natur die Rolle des Menschen bei der Selektion auf bestimmte Merkmale übernommen hat. Zu diesem Schluss kam er aufgrund von zwei Beobachtungen und zwei Schlussfolgerungen. Erstens neigen die Mitglieder einer Population dazu, sich in ihren vererbbaren Merkmalen zu unterscheiden. Zweitens neigen alle Arten dazu, mehr Nachkommen zu produzieren, als ihre jeweilige Umwelt verkraften kann, was dazu führt, dass viele Individuen nicht überleben und sich nicht fortpflanzen. Aus diesen Beobachtungen schloss Darwin, dass diejenigen Individuen, die vererbbare Merkmale besitzen, die besser an ihre Umwelt angepasst sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit überleben und mehr Nachkommen produzieren als andere Individuen. Er folgerte ferner, dass das ungleiche oder unterschiedliche Überleben und die Reproduktion bestimmter Individuen im Vergleich zu anderen zu einer Anhäufung vorteilhafter Merkmale über aufeinanderfolgende Generationen hinweg führen wird, wodurch die Übereinstimmung zwischen den Organismen und ihrer Umwelt erhöht wird. Zusammengefasst bedeutet natürliche Selektion also das unterschiedliche Überleben und die unterschiedliche Fortpflanzung von Individuen in den nachfolgenden Generationen aufgrund von Unterschieden bei den vererbbaren Merkmalen. ⓘ
Darwin kannte Mendels Arbeit über die Vererbung nicht, und so war der genaue Mechanismus der Vererbung, der der natürlichen Auslese zugrunde liegt, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht gut verstanden, als die moderne Synthese die darwinistische Evolution mit der klassischen Genetik in Einklang brachte, wodurch eine neodarwinistische Perspektive der Evolution durch natürliche Auslese geschaffen wurde. Nach dieser Sichtweise findet Evolution statt, wenn sich die Allelhäufigkeiten in einer Population von sich kreuzenden Organismen verändern. Wenn es keinen evolutionären Prozess gibt, der auf eine große Population mit zufälliger Paarung einwirkt, bleiben die Allelhäufigkeiten über Generationen hinweg konstant, wie es das Hardy-Weinberg-Prinzip beschreibt. ⓘ
Ein weiterer Prozess, der die Evolution vorantreibt, ist die genetische Drift, d. h. die zufälligen Schwankungen der Allelhäufigkeiten innerhalb einer Population von einer Generation zur nächsten. Bei fehlenden oder relativ schwachen Selektionskräften ist es gleich wahrscheinlich, dass die Allelhäufigkeiten in jeder aufeinander folgenden Generation nach oben oder unten driften, da die Allele einem Stichprobenfehler unterliegen. Diese Drift kommt zum Stillstand, wenn ein Allel schließlich fixiert wird, indem es entweder aus der Population verschwindet oder die anderen Allele vollständig verdrängt. Durch die genetische Drift können daher einige Allele allein durch Zufall aus einer Population eliminiert werden. ⓘ
Artbildung

Eine Art ist eine Gruppe von Organismen, die sich miteinander paaren, und Speziation ist der Prozess, bei dem sich eine Abstammungslinie in zwei Abstammungslinien aufspaltet, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Damit es zur Artbildung kommt, muss eine reproduktive Isolation vorliegen. Reproduktive Isolation kann durch Inkompatibilitäten zwischen Genen entstehen, wie im Bateson-Dobzhansky-Muller-Modell beschrieben. Die reproduktive Isolation nimmt mit der genetischen Divergenz tendenziell zu. Zur Artbildung kann es kommen, wenn physische Barrieren eine angestammte Art trennen, ein Prozess, der als allopatrische Artbildung bekannt ist. Im Gegensatz dazu findet sympatrische Speziation statt, wenn keine physischen Barrieren vorhanden sind. ⓘ
Vorzygotische Isolation wie mechanische, zeitliche, verhaltensbedingte, lebensraumbedingte und gametische Isolation kann die Hybridisierung verschiedener Arten verhindern. Ebenso können postzygotische Isolierungen dazu führen, dass aufgrund der geringeren Lebensfähigkeit von Hybriden oder der Unfruchtbarkeit von Hybriden (z. B. Maultier) gegen Hybridisierung selektiert wird. Hybridzonen können entstehen, wenn eine unvollständige reproduktive Isolation zwischen zwei eng verwandten Arten besteht. ⓘ
Phylogenie
<imagemap>-Fehler: Am Ende von Zeile 8 wurde kein gültiger Link gefunden
Eine Phylogenie ist die Evolutionsgeschichte einer bestimmten Gruppe von Organismen oder deren Genen. Sie kann mit Hilfe eines phylogenetischen Baums dargestellt werden, einem Diagramm, das die Abstammungslinien zwischen Organismen oder ihren Genen zeigt. Jede Linie, die auf der Zeitachse eines Baumes gezeichnet wird, stellt eine Abstammungslinie von Nachkommen einer bestimmten Art oder Population dar. Wenn sich eine Abstammungslinie in zwei Teile teilt, wird dies als Knoten (oder Abspaltung) auf dem phylogenetischen Baum dargestellt. Je mehr Abspaltungen es im Laufe der Zeit gibt, desto mehr Äste hat der Baum, wobei der gemeinsame Vorfahre aller Organismen in diesem Baum durch die Wurzel des Baums dargestellt wird. Phylogenetische Bäume können die Evolutionsgeschichte aller Lebensformen, einer großen Evolutionsgruppe (z. B. Insekten) oder einer noch kleineren Gruppe eng verwandter Arten darstellen. Innerhalb eines Stammbaums ist jede Gruppe von Arten, die mit einem Namen bezeichnet wird, ein Taxon (z. B. Menschen, Primaten, Säugetiere oder Wirbeltiere), und ein Taxon, das aus allen seinen evolutionären Nachkommen besteht, ist eine Klade, auch bekannt als monophyletisches Taxon. Eng verwandte Arten werden als Schwesterarten bezeichnet und eng verwandte Kladen als Schwesterkladen. Im Gegensatz zu einer monophyletischen Gruppe umfasst eine polyphyletische Gruppe nicht ihren gemeinsamen Vorfahren, während eine paraphyletische Gruppe nicht alle Nachkommen eines gemeinsamen Vorfahren umfasst. ⓘ
Phylogenetische Bäume sind die Grundlage für den Vergleich und die Gruppierung verschiedener Arten. Verschiedene Arten, die ein von einem gemeinsamen Vorfahren geerbtes Merkmal teilen, werden als homologe Merkmale (oder Synapomorphie) bezeichnet. Homologe Merkmale können alle vererbbaren Eigenschaften wie DNA-Sequenz, Proteinstrukturen, anatomische Merkmale und Verhaltensmuster sein. Die Wirbelsäule ist ein Beispiel für ein homologes Merkmal, das alle Wirbeltiere gemeinsam haben. Merkmale, die eine ähnliche Form oder Funktion haben, aber nicht von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, werden als analoge Merkmale bezeichnet. Phylogenien können für eine Gruppe von Organismen rekonstruiert werden, die von primärem Interesse sind und als "Ingroup" bezeichnet werden. Eine Art oder Gruppe, die eng mit der Ingroup verwandt ist, aber phylogenetisch außerhalb der Ingroup liegt, wird als Outgroup bezeichnet und dient als Referenzpunkt im Baum. Die Wurzel des Baumes befindet sich zwischen der Ingroup und der Outgroup. Bei der Rekonstruktion von phylogenetischen Bäumen können mehrere Bäume mit unterschiedlichen Evolutionsgeschichten erstellt werden. Nach dem Prinzip der Parsimonie (oder Occams Rasiermesser) wird derjenige Baum bevorzugt, der die wenigsten evolutionären Veränderungen aufweist, die über alle Merkmale in allen Gruppen hinweg angenommen werden müssen. Mit Hilfe von Computeralgorithmen lässt sich ermitteln, wie sich ein Baum angesichts der Beweise entwickelt haben könnte. ⓘ
Die Phylogenie bildet die Grundlage der biologischen Klassifizierung, die auf der von Carl Linnaeus im 18. Jahrhundert entwickelten Linnaeischen Taxonomie beruht. Jahrhundert entwickelt wurde. Dieses Klassifizierungssystem ist rangbasiert, wobei der höchste Rang die Domäne ist, gefolgt von Königreich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art. Alle Organismen können einem von drei Bereichen zugeordnet werden: Archaea (ursprünglich Archaebakterien), Bakterien (ursprünglich Eubakterien) oder Eukarya (umfasst die Reiche der Protisten, Pilze, Pflanzen und Tiere). Zur Klassifizierung der verschiedenen Arten wird eine binomiale Nomenklatur verwendet. Auf der Grundlage dieses Systems erhält jede Art zwei Namen, einen für ihre Gattung und einen für ihre Art. Der Mensch ist zum Beispiel Homo sapiens, wobei Homo die Gattung und sapiens die Art ist. Die wissenschaftlichen Namen von Organismen werden kursiv geschrieben, wobei nur der erste Buchstabe der Gattung groß geschrieben wird. ⓘ
Geschichte des Lebens
Zeitleiste des Lebens ⓘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−4500 — – — – −4000 — – — – −3500 — – — – −3000 — – — – −2500 — – — – −2000 — – — – −1500 — – — – −1000 — – — – −500 — – — – 0 — | Wasser Einzelliges Leben Photosynthese Vielzelliges Leben P l a n t s Gliederfüßer Weichtiere H a d e a n A r c h e a n P r o t e r o z o i c P h a n e r o z o i c |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vor Millionen Jahren) *Eiszeitalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschichte des Lebens auf der Erde zeichnet die Prozesse nach, durch die sich die Organismen von den ersten Anfängen des Lebens bis heute entwickelt haben. Die Erde entstand vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, und alles Leben auf der Erde, sowohl das lebende als auch das ausgestorbene, stammt von einem letzten universellen gemeinsamen Vorfahren ab, der vor etwa 3,5 Milliarden Jahren lebte. Die Erdgeschichte kann mit verschiedenen geologischen Methoden wie Stratigraphie, radiometrischer Datierung und paläomagnetischer Datierung datiert werden. Auf der Grundlage dieser Methoden haben Geologen eine geologische Zeitskala entwickelt, die die Geschichte der Erde in große Abschnitte unterteilt, beginnend mit vier Äonen (Erdzeitalter, Archaikum, Proterozoikum und Phanerozoikum), von denen die ersten drei zusammen als Präkambrium bezeichnet werden, das etwa 4 Milliarden Jahre dauerte. Jedes Äon kann in Epochen unterteilt werden, wobei das Phanerozoikum, das vor 539 Millionen Jahren begann, in die Epochen Paläozoikum, Mesozoikum und Känozoikum unterteilt wird. Diese drei Epochen umfassen zusammen elf Perioden (Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär und Quartär) und jede Periode in Epochen. ⓘ
Die Ähnlichkeiten zwischen allen heute bekannten Arten deuten darauf hin, dass sie sich im Laufe der Evolution von ihrem gemeinsamen Vorfahren entfernt haben. Biologen betrachten die Allgegenwart des genetischen Codes als Beweis für eine universelle gemeinsame Abstammung aller Bakterien, Archaeen und Eukaryoten. Mikromatten aus nebeneinander existierenden Bakterien und Archaeen waren die vorherrschende Lebensform in der frühen Archaischen Epoche, und es wird angenommen, dass viele der wichtigsten Schritte der frühen Evolution in dieser Umgebung stattgefunden haben. Die frühesten Nachweise von Eukaryoten stammen von vor 1,85 Milliarden Jahren, und obwohl sie möglicherweise schon früher vorhanden waren, beschleunigte sich ihre Diversifizierung, als sie begannen, Sauerstoff für ihren Stoffwechsel zu nutzen. Später, vor etwa 1,7 Milliarden Jahren, traten mehrzellige Organismen mit differenzierten Zellen auf, die spezialisierte Funktionen ausübten. ⓘ
Algenähnliche mehrzellige Landpflanzen werden sogar auf die Zeit vor etwa 1 Milliarde Jahren datiert, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass Mikroorganismen die frühesten terrestrischen Ökosysteme vor mindestens 2,7 Milliarden Jahren bildeten. Es wird angenommen, dass Mikroorganismen den Weg für die Entstehung von Landpflanzen im Ordovizium geebnet haben. Die Landpflanzen waren so erfolgreich, dass sie vermutlich zum Aussterben des späten Devons beigetragen haben. ⓘ
Die Ediacara-Biota tauchen im Ediacaran auf, während die Wirbeltiere zusammen mit den meisten anderen modernen Phyla vor etwa 525 Millionen Jahren während der Kambrischen Explosion entstanden. Während des Perms beherrschten Synapsiden, darunter auch die Vorfahren der Säugetiere, das Land, aber der größte Teil dieser Gruppe starb während des Perm-Trias-Sterbeereignisses vor 252 Millionen Jahren aus. Während der Erholung von dieser Katastrophe wurden die Archosaurier zu den häufigsten Landwirbeltieren; eine Archosauriergruppe, die Dinosaurier, dominierte die Jura- und Kreidezeit. Nachdem das Aussterbeereignis der Kreidezeit und des Paläogens vor 66 Millionen Jahren die nicht-avischen Dinosaurier ausgelöscht hatte, nahmen Säugetiere rasch an Größe und Vielfalt zu. Solche Massenaussterben könnten die Evolution beschleunigt haben, indem sie neuen Organismengruppen die Möglichkeit zur Diversifizierung boten. ⓘ
Vielfalt
Bakterien und Archaeen
Bakterien sind ein Zelltyp, der einen großen Bereich prokaryontischer Mikroorganismen darstellt. Bakterien sind in der Regel nur wenige Mikrometer lang und haben eine Reihe von Formen, die von Kugeln über Stäbchen bis hin zu Spiralen reichen. Bakterien gehörten zu den ersten Lebensformen, die auf der Erde auftauchten, und sind in den meisten Lebensräumen der Erde zu finden. Bakterien leben im Boden, im Wasser, in sauren heißen Quellen, in radioaktiven Abfällen und in der tiefen Biosphäre der Erdkruste. Bakterien leben auch in symbiotischen und parasitären Beziehungen mit Pflanzen und Tieren. Die meisten Bakterien sind noch nicht charakterisiert, und nur etwa 27 Prozent der bakteriellen Phyla haben Arten, die im Labor gezüchtet werden können. ⓘ
Archaeen bilden die andere Domäne der prokaryotischen Zellen und wurden ursprünglich als Bakterien klassifiziert und erhielten den Namen Archaebakterien (im Reich der Archaebakterien), ein Begriff, der inzwischen nicht mehr verwendet wird. Archaeenzellen haben einzigartige Eigenschaften, die sie von den anderen beiden Bereichen, den Bakterien und den Eukaryonten, unterscheiden. Archaeen sind außerdem in mehrere anerkannte Phyla unterteilt. Archaeen und Bakterien ähneln sich im Allgemeinen in Größe und Form, obwohl einige Archaeen sehr unterschiedliche Formen haben, wie z. B. die flachen und quadratischen Zellen von Haloquadratum walsbyi. Trotz dieser morphologischen Ähnlichkeit mit Bakterien besitzen Archaeen Gene und mehrere Stoffwechselwege, die enger mit denen von Eukaryoten verwandt sind, insbesondere für die an der Transkription und Translation beteiligten Enzyme. Andere Aspekte der Biochemie von Archaeen sind einzigartig, wie z. B. ihre Abhängigkeit von Etherlipiden in ihren Zellmembranen, einschließlich Archaeolen. Archaeen nutzen mehr Energiequellen als Eukaryoten: Diese reichen von organischen Verbindungen wie Zucker bis hin zu Ammoniak, Metallionen und sogar Wasserstoffgas. Salztolerante Archaeen (die Haloarchaeen) nutzen Sonnenlicht als Energiequelle, und andere Archaeenarten fixieren Kohlenstoff, aber im Gegensatz zu Pflanzen und Cyanobakterien kann keine bekannte Archaeenart beides. Archaeen vermehren sich ungeschlechtlich durch Binärspaltung, Fragmentierung oder Knospung; im Gegensatz zu Bakterien bildet keine bekannte Archaeenart Endosporen. ⓘ
Die ersten beobachteten Archaeen waren extremophil und lebten in extremen Umgebungen wie heißen Quellen und Salzseen ohne andere Organismen. Verbesserte molekulare Nachweismethoden führten zur Entdeckung von Archaeen in fast allen Lebensräumen, einschließlich Böden, Ozeanen und Sümpfen. Archaeen sind in den Ozeanen besonders zahlreich vertreten, und die Archaeen im Plankton sind möglicherweise eine der häufigsten Organismengruppen auf unserem Planeten. ⓘ
Archaeen sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens auf der Erde. Sie sind Teil der Mikrobiota aller Organismen. Im menschlichen Mikrobiom spielen sie eine wichtige Rolle im Darm, im Mund und auf der Haut. Ihre morphologische, metabolische und geografische Vielfalt ermöglicht es ihnen, zahlreiche ökologische Aufgaben zu erfüllen: Kohlenstofffixierung, Stickstoffkreislauf, Umsatz organischer Verbindungen und Aufrechterhaltung mikrobieller symbiotischer und syntropher Gemeinschaften. ⓘ
Protisten

Es wird angenommen, dass sich Eukaryoten von Archaeen abgespalten haben, worauf ihre Endosymbiosen mit Bakterien (oder Symbiogenese) folgten, aus denen Mitochondrien und Chloroplasten hervorgingen, die beide heute Teil der modernen eukaryontischen Zellen sind. Die Hauptlinien der Eukaryonten haben sich im Präkambrium vor etwa 1,5 Milliarden Jahren diversifiziert und lassen sich in acht Hauptgruppen einteilen: Alveolaten, Exkavaten, Stramenopile, Pflanzen, Rhizarier, Amöbozoen, Pilze und Tiere. Fünf dieser Gruppen sind als Protisten bekannt, bei denen es sich meist um mikroskopisch kleine eukaryotische Organismen handelt, die keine Pflanzen, Pilze oder Tiere sind. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die Protisten einen gemeinsamen Vorfahren haben (den letzten gemeinsamen eukaryotischen Vorfahren), stellen die Protisten für sich genommen keine eigenständige Gruppe dar, da einige Protisten enger mit Pflanzen, Pilzen oder Tieren verwandt sein können als mit anderen Protisten. Wie Gruppen wie Algen, Wirbellose oder Protozoen ist auch die Gruppe der Protisten keine formale taxonomische Gruppe, sondern wird nur der Einfachheit halber verwendet. Die meisten Protisten sind einzellige Lebewesen, die auch als mikrobielle Eukaryoten bezeichnet werden. ⓘ
Bei den Alveolaten handelt es sich meist um photosynthetische einzellige Protisten, die unter ihrer Zellmembran Säcke besitzen, die Alveolen genannt werden (daher der Name Alveolaten) und die die Zelloberfläche stützen. Zu den Alveolaten gehören mehrere Gruppen wie Dinoflagellaten, Apikomplexe und Ciliaten. Dinoflagellaten sind photosynthetisch und kommen im Meer vor, wo sie eine Rolle als Primärproduzenten organischer Stoffe spielen. Apikomplexe sind parasitische Alveolen, die einen apikalen Komplex besitzen, eine Gruppe von Organellen, die sich am apikalen Ende der Zelle befinden. Dieser Komplex ermöglicht es den Apikomplexen, in das Gewebe ihrer Wirte einzudringen. Wimperntierchen sind Alveolen, die zahlreiche haarähnliche Strukturen, die so genannten Zilien, besitzen. Ein charakteristisches Merkmal der Wimpertierchen ist das Vorhandensein von zwei Arten von Zellkernen in jeder Wimpertierchenzelle. Ein häufig untersuchter Wimpertierchen-Typ ist das Paramecium. ⓘ
Die Exkavaten sind eine Gruppe von Protisten, die sich vor etwa 1,5 Milliarden Jahren kurz nach der Entstehung der Eukaryoten zu diversifizieren begannen. Einige Exkavaten besitzen keine Mitochondrien, von denen man annimmt, dass sie im Laufe der Evolution verloren gegangen sind, da diese Protisten noch Kerngene besitzen, die mit den Mitochondrien verbunden sind. Zu den Exkavaten gehören mehrere Gruppen wie die Diplomonaden, Parabasaliden, Heteroloboseen, Eugleniden und Kinetoplastiden. ⓘ
Zu den Stramenopilen, von denen die meisten durch das Vorhandensein von röhrenförmigen Haaren an der längeren der beiden Geißeln gekennzeichnet sind, gehören Kieselalgen und Braunalgen. Kieselalgen sind Primärproduzenten und tragen zu etwa einem Fünftel der gesamten photosynthetischen Kohlenstofffixierung bei, was sie zu einem Hauptbestandteil des Phytoplanktons macht. ⓘ
Rhizarianer sind meist einzellige und aquatische Protisten, die typischerweise lange, dünne Pseudopodien besitzen. Zu den Rhizarianern gehören drei Hauptgruppen: Cercozoen, Foraminiferen und Radiolarien. ⓘ
Amöbozoen sind Protisten mit einer Körperform, die sich durch das Vorhandensein von lappenförmigen Pseudopodien auszeichnet, die ihnen bei der Fortbewegung helfen. Zu ihnen gehören Gruppen wie Loboseen und Schleimpilze (z. B. plasmodische Schleimpilze und zelluläre Schleimpilze). ⓘ
Vielfalt der Pflanzen

Pflanzen sind hauptsächlich mehrzellige Organismen, überwiegend photosynthetische Eukaryoten aus dem Reich der Pflanzen (Plantae), was Pilze und einige Algen ausschließt. Ein gemeinsames abgeleitetes Merkmal (oder eine Synapomorphie) der Plantae ist die primäre Endosymbiose eines Cyanobakteriums mit einem frühen Eukaryonten vor etwa einer Milliarde Jahren, aus der die Chloroplasten hervorgingen. Die ersten Kladen, die nach der primären Endosymbiose entstanden, waren aquatisch, und die meisten der aquatischen photosynthetischen eukaryotischen Organismen werden als Algen bezeichnet. Algen umfassen mehrere verschiedene Gruppen, wie z. B. die Glaukophyten, mikroskopisch kleine Süßwasseralgen, die in ihrer Form möglicherweise dem frühen einzelligen Vorläufer der Plantae ähnelten. Im Gegensatz zu den Glaukophyten sind die anderen Algengruppen, wie Rot- und Grünalgen, mehrzellig. Grünalgen umfassen drei Hauptgruppen: Chlorophyten, Coleochaetophyten und Steinkraut. ⓘ
Landpflanzen (Embryophyten) traten erstmals vor etwa 450 bis 500 Millionen Jahren in terrestrischen Umgebungen auf. Eine Synapomorphie der Landpflanzen ist ein Embryo, der sich unter dem Schutz des Gewebes der Mutterpflanze entwickelt. Die Landpflanzen umfassen zehn Hauptkladen, von denen sieben eine einzige Klade bilden, die als Gefäßpflanzen (oder Tracheophyten) bekannt ist, da sie alle Tracheiden, d. h. flüssigkeitsleitende Zellen, und ein gut entwickeltes System haben, das Materialien durch ihren Körper transportiert. Im Gegensatz dazu sind die anderen drei Kladen keine Gefäßpflanzen, da sie keine Tracheiden haben. Sie bilden auch keine einheitliche Gruppe. ⓘ
Zu den Nicht-Gefäßpflanzen gehören Leberblümchen, Moose und Hornblumen. Sie sind in der Regel in Gebieten zu finden, in denen Wasser leicht verfügbar ist. Die meisten leben auf dem Boden oder sogar auf den Gefäßpflanzen selbst. Einige können auf nacktem Fels, abgestorbenen oder umgestürzten Baumstämmen und sogar auf Gebäuden wachsen. Die meisten Nicht-Gefäßpflanzen sind terrestrisch, einige wenige leben in Süßwasserumgebungen und keine in den Ozeanen. ⓘ
Zu den sieben Kladen (oder Abteilungen), die die Gefäßpflanzen bilden, gehören Schachtelhalme und Farne, die als eine einzige Klade, die Monilophyten, zusammengefasst werden können. Die Samenpflanzen (oder Spermatophyten) bilden die anderen fünf Abteilungen, von denen vier zu den Gymnospermen und eine zu den Angiospermen gehören. Zu den Gymnospermen gehören Nadelbäume, Zykaden, Ginkgo und Gnetophyten. Die Samen der Gymnospermen entwickeln sich entweder auf der Oberfläche von Schuppen oder Blättern, die oft zu Kegeln umgebaut sind, oder einzeln wie bei Eibe, Torreya und Ginkgo. Die Bedecktsamer sind mit 64 Ordnungen, 416 Familien, etwa 13.000 bekannten Gattungen und 300.000 bekannten Arten die vielfältigste Gruppe der Landpflanzen. Wie die Gymnospermen sind auch die Angiospermen samenbildende Pflanzen. Sie unterscheiden sich von den Gymnospermen durch Merkmale wie Blüten, Endosperm in den Samen und die Bildung von Früchten, die die Samen enthalten. ⓘ
Pilze

Pilze sind eukaryotische Organismen, die Nahrung außerhalb ihres Körpers verdauen. Dabei scheiden sie zunächst Verdauungsenzyme aus, die große Nahrungsmoleküle aufspalten, bevor sie diese durch ihre Zellmembranen absorbieren. Viele Pilze sind auch Saprobien, da sie in der Lage sind, Nährstoffe aus abgestorbenen organischen Stoffen aufzunehmen, und somit die wichtigsten Zersetzer in ökologischen Systemen sind. Einige Pilze sind Parasiten, indem sie Nährstoffe von lebenden Wirten absorbieren, während andere auf Gegenseitigkeit beruhen. Pilze können zusammen mit zwei anderen Gattungen, den Choanoflagellaten und den Tieren, zu den Opisthokonten gezählt werden. Eine Synapomorphie, die Pilze von den beiden anderen Opisthokonten unterscheidet, ist das Vorhandensein von Chitin in ihren Zellwänden. ⓘ
Die meisten Pilze sind mehrzellig, aber einige sind einzellig, wie z. B. Hefen, die in einer flüssigen oder feuchten Umgebung leben und in der Lage sind, Nährstoffe direkt in ihre Zelloberfläche aufzunehmen. Mehrzellige Pilze hingegen haben einen Körper, der Myzel genannt wird und aus einer Masse einzelner röhrenförmiger Fäden besteht, die Hyphen genannt werden und die Nährstoffaufnahme ermöglichen. ⓘ
Pilze lassen sich anhand ihrer Lebenszyklen in sechs große Gruppen einteilen: Mikrosporidien, Chytriden, Zygosporenpilze (Zygomycota), arbuskuläre Mykorrhizapilze (Glomeromycota), Schlauchpilze (Ascomycota) und Keulenpilze (Basidiomycota). Pilze werden nach den besonderen Verfahren der sexuellen Fortpflanzung eingeteilt, die sie anwenden. Die üblichen zellulären Produkte der Meiose während der sexuellen Fortpflanzung sind Sporen, die so angepasst sind, dass sie raue Zeiten überleben und sich verbreiten können. Ein wichtiger adaptiver Nutzen der Meiose während der sexuellen Fortpflanzung in den Ascomycota und Basidiomycota wurde in der Reparatur von DNA-Schäden durch meiotische Rekombination gesehen. ⓘ
Das Pilzreich umfasst eine enorme Vielfalt an Taxa mit unterschiedlichen Ökologien, Lebenszyklusstrategien und Morphologien, die von einzelligen aquatischen Chytriden bis zu großen Pilzen reichen. Über die tatsächliche biologische Vielfalt des Königreichs der Pilze, die auf 2,2 bis 3,8 Millionen Arten geschätzt wird, ist jedoch nur wenig bekannt. Von diesen sind nur etwa 148.000 beschrieben, wobei über 8.000 Arten als schädlich für Pflanzen bekannt sind und mindestens 300 Arten für den Menschen pathogen sein können. ⓘ
Vielfalt der Tiere

Tiere sind vielzellige eukaryotische Organismen, die das Reich der Tiere (Animalia) bilden. Mit wenigen Ausnahmen verzehren Tiere organisches Material, atmen Sauerstoff, können sich bewegen, sich geschlechtlich fortpflanzen und wachsen während der Embryonalentwicklung aus einer Hohlkugel von Zellen, der Blastula, heran. Es sind über 1,5 Millionen lebende Tierarten beschrieben worden, von denen etwa 1 Million Insekten sind, aber man schätzt, dass es insgesamt über 7 Millionen Tierarten gibt. Sie stehen in komplexen Wechselbeziehungen zueinander und zu ihrer Umwelt und bilden komplizierte Nahrungsnetze. ⓘ
Anhand ihrer Entwicklungsmerkmale lassen sich die Tiere in zwei Gruppen einteilen. So haben die Embryonen diploblastischer Tiere wie Ctenophoren, Placeozoen und Nesseltiere zwei Zellschichten (Ektoderm und Endoderm), während die Embryonen triploblastischer Tiere drei Gewebeschichten (Ektoderm, Mesoderm und Endoderm) aufweisen, was eine Synapomorphie dieser Tiere ist. Triploblastische Tiere lassen sich anhand des Musters der Gastrulation, bei der sich aus der Vertiefung einer Blastula ein Hohlraum, die so genannte Blastopore, bildet, in zwei Hauptkladen unterteilen. Bei den Protostomiern bildet sich aus der Blastopore der Mund, dem dann die Bildung des Anus folgt. Bei den Deuterostomiern entsteht aus der Blastopore der Anus, gefolgt von der Bildung des Mundes. ⓘ
Tiere können auch anhand ihres Körperbaus unterschieden werden, und zwar anhand von vier Hauptmerkmalen: Symmetrie, Körperhöhle, Segmentierung und Anhängsel. Die Körper der meisten Tiere sind symmetrisch, wobei die Symmetrie entweder radial oder bilateral ist. Triploblastische Tiere können anhand ihrer Körperhöhle in drei Typen unterteilt werden: acoelomate, pseudocoelomate und coelomate. Bei vielen Tieren ist eine Segmentierung des Körpers zu beobachten, die eine Spezialisierung der verschiedenen Körperteile ermöglicht und es dem Tier erlaubt, die Form seines Körpers zu verändern, um seine Bewegungen zu kontrollieren. Schließlich lassen sich Tiere anhand der Art und Lage ihrer Fortsätze unterscheiden, wie z. B. der Antennen zur Erkennung der Umgebung oder der Krallen zum Ergreifen von Beutetieren. ⓘ
Schwämme, die Mitglieder des Stammes der Porifera, gehören zu den basalen Metazoa (Tieren) und sind eine Schwestergruppe der Diploblasten. Sie sind vielzellige Organismen mit einem Körper voller Poren und Kanäle, durch die Wasser zirkulieren kann, und bestehen aus einem gallertartigen Mesohyl, das zwischen zwei dünnen Zellschichten liegt. ⓘ
Die meisten Tierarten (~97 %) sind wirbellose Tiere, d. h. Tiere, die keine Wirbelsäule (oder Rückgrat oder Wirbelsäule) haben, die sich vom Notochord ableitet. Dazu gehören alle Tiere mit Ausnahme des Unterstamms der Wirbeltiere (Vertebrata). Bekannte Beispiele für Wirbellose sind Schwämme, Nesseltiere (Hydren, Quallen, Seeanemonen und Korallen), Weichtiere (Chitons, Schnecken, Muscheln, Tintenfische und Kraken), Ringelwürmer (Regenwürmer und Blutegel) und Gliederfüßer (Insekten, Spinnentiere, Krebstiere und Myriapoden). Viele wirbellose Taxa weisen eine größere Anzahl und Vielfalt an Arten auf als der gesamte Unterstamm der Wirbeltiere. ⓘ
Im Gegensatz dazu umfassen die Wirbeltiere alle Arten von Tieren innerhalb des Unterstamms Vertebrata, die Chordaten mit Wirbelsäulen sind. Diese Tiere haben vier Hauptmerkmale: einen vorderen Schädel mit einem Gehirn, ein starres inneres Skelett, das von einer Wirbelsäule gestützt wird, die ein Rückenmark umschließt, innere Organe, die in einem Coelom aufgehängt sind, und ein gut entwickeltes Kreislaufsystem, das von einem einzigen großen Herzen angetrieben wird. Wirbeltiere stellen die überwältigende Mehrheit des Stammes der Chordata dar; derzeit sind etwa 69.963 Arten beschrieben. Wirbeltiere umfassen verschiedene Hauptgruppen, darunter kieferlose Fische (ohne Schleimaale), Wirbeltiere mit Kiefern wie Knorpelfische (Haie, Rochen und Laufvögel), Knochenfische, Tetrapoden wie Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. ⓘ
Die beiden verbleibenden Gruppen von Fischen ohne Kiefer, die über das Devon hinaus überlebt haben, sind Schleimaale und Neunaugen, die als Zyklostomier (für kreisförmige Mäuler) bezeichnet werden. Beide Tiergruppen haben einen langgestreckten, aalähnlichen Körper ohne paarige Flossen. Da Schleimaale jedoch ein schwaches Kreislaufsystem mit drei akzessorischen Herzen, einen Teilschädel ohne Kleinhirn, keinen Kiefer oder Magen und keine gegliederten Wirbel haben, werden sie von einigen Biologen nicht als Wirbeltiere, sondern als Schwestergruppe der Wirbeltiere eingestuft. Im Gegensatz dazu haben Neunaugen einen vollständigen Schädel und eine ausgeprägte Wirbelsäule, die knorpelig ist. ⓘ
Säugetiere haben vier Hauptmerkmale, die sie von anderen Tieren unterscheiden: Schweißdrüsen, Brustdrüsen, Haare und ein Herz mit vier Kammern. Kleine und mittelgroße Säugetiere lebten während eines Großteils des Mesozoikums zusammen mit großen Dinosauriern, verschwanden aber bald nach dem Massenaussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit. Es gibt etwa 57.000 Säugetierarten, die in zwei Hauptgruppen unterteilt werden können: Prototherier und Therier. Prototherier besitzen keine Brustwarzen, sondern sondern sondern Milch auf ihrer Haut ab, die sie ihren Nachkommen aus dem Fell saugen lassen. Außerdem haben sie keine Plazenta, legen keine Eier und haben Spreizfüße. Derzeit sind nur fünf Arten von Prototherien bekannt (Schnabeltiere und vier Arten von Schnabeligeln). Die Gruppe der Theropoden ist lebendgebärend und kann in zwei Gruppen unterteilt werden: Beuteltiere und Eutertiere. Die Weibchen der Beuteltiere haben einen Bauchbeutel, in dem sie ihren Nachwuchs tragen und füttern. Die Eutherier bilden die Mehrheit der Säugetiere und umfassen wichtige Gruppen wie Nagetiere, Fledermäuse, Paarhufer und Wale, Spitzmäuse und Maulwürfe, Primaten, Fleischfresser, Kaninchen, afrikanische Insektenfresser, stachelige Insektenfresser, Gürteltiere, Baumspitzmäuse, Paarhufer mit ungeraden Zehen, Langnasen-Insektenfresser, Ameisenbären und Faultiere, Schuppentiere, Hyraxe, Sirenen, Elefanten, Kolosse und Erdferkel. ⓘ
Vor etwa 90 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, kam es zu einer Spaltung der Primatenlinie, aus der zwei große Gruppen hervorgingen: die Prosimier und die Anthropoiden. Zu den Prosimiern gehören Lemuren, Loris und Galagos, während zu den Anthropoiden Tarsier, Neuweltaffen, Altweltaffen und Menschenaffen gehören. Die Affen trennten sich vor etwa 35 Millionen Jahren von den Altweltaffen, wobei verschiedene Arten zwischen 22 und 5,5 Millionen Jahren in Afrika, Europa und Asien lebten. Zu den modernen Nachfahren dieser Tiere gehören Schimpansen und Gorillas in Afrika, Gibbons und Orang-Utans in Asien und der Mensch weltweit. Vor etwa sechs Millionen Jahren kam es in Afrika zu einer Spaltung des Affenstamms, aus der die Schimpansen als eine Gruppe und die Hominiden als eine andere Gruppe hervorgingen, zu der auch die Menschen und ihre ausgestorbenen Verwandten gehören. Die frühesten Protohominiden, die als Ardipithecinen bekannt sind, waren zweibeinig. Als Anpassung brachte die Zweibeinigkeit drei Vorteile mit sich. Erstens konnten die Ardipithecinen bei der Arbeit ihre Vorderbeine zum Manipulieren und Tragen von Gegenständen einsetzen. Zweitens waren die Augen der Tiere dadurch besser in der Lage, Beute oder Raubtiere in der hohen Vegetation zu erkennen. Und schließlich ist die Zweibeinigkeit energetisch effizienter als die vierbeinige Fortbewegung. ⓘ
Viren

Viren sind submikroskopische Infektionserreger, die sich in den Zellen von Organismen vermehren. Viren infizieren alle Arten von Lebensformen, von Tieren und Pflanzen bis hin zu Mikroorganismen, einschließlich Bakterien und Archaeen. Mehr als 6.000 Virusarten sind im Detail beschrieben worden. Viren kommen in fast allen Ökosystemen der Erde vor und sind die zahlreichste Art von biologischen Lebewesen. ⓘ
Wenn eine Wirtszelle infiziert wird, ist sie gezwungen, schnell Tausende identischer Kopien des ursprünglichen Virus zu produzieren. Wenn sie sich nicht in einer infizierten Zelle befinden oder gerade dabei sind, eine Zelle zu infizieren, existieren Viren in Form unabhängiger Partikel oder Virionen, die aus dem genetischen Material (DNA oder RNA), einer Proteinhülle, dem so genannten Kapsid, und in einigen Fällen einer Außenhülle aus Lipiden bestehen. Die Formen dieser Viruspartikel reichen von einfachen spiralförmigen und ikosaedrischen Formen bis hin zu komplexeren Strukturen. Die meisten Virusarten haben Virionen, die zu klein sind, um mit einem optischen Mikroskop gesehen zu werden, da sie nur ein Hundertstel so groß sind wie die meisten Bakterien. ⓘ
Die Ursprünge der Viren in der Evolutionsgeschichte des Lebens sind unklar: Einige könnten sich aus Plasmiden entwickelt haben - DNA-Stücke, die sich zwischen Zellen bewegen können -, während andere sich aus Bakterien entwickelt haben könnten. In der Evolution sind Viren ein wichtiges Mittel für den horizontalen Gentransfer, der die genetische Vielfalt in ähnlicher Weise wie die sexuelle Fortpflanzung erhöht. Da Viren einige, aber nicht alle Merkmale des Lebens besitzen, wurden sie als "Organismen am Rande des Lebens" und als Selbstreplikatoren bezeichnet. ⓘ
Viren können sich auf viele Arten verbreiten. Ein Übertragungsweg ist der über krankheitstragende Organismen, die als Vektoren bekannt sind: So werden Viren häufig durch Insekten, die sich von Pflanzensaft ernähren, wie z. B. Blattläuse, von Pflanze zu Pflanze übertragen, und Viren bei Tieren können durch blutsaugende Insekten übertragen werden. Influenzaviren werden durch Husten und Niesen übertragen. Noroviren und Rotaviren, häufige Erreger viraler Gastroenteritis, werden über den fäkal-oralen Weg übertragen, d. h. durch Kontakt von Hand zu Mund oder über Lebensmittel oder Wasser. Virusinfektionen bei Tieren lösen eine Immunreaktion aus, die in der Regel das infizierende Virus eliminiert. Immunreaktionen können auch durch Impfstoffe hervorgerufen werden, die eine künstlich erworbene Immunität gegen die spezifische Virusinfektion verleihen. ⓘ
Sie ist die Wissenschaft und Lehre von den Mikroorganismen, also von den Lebewesen, die als Individuen nicht mit bloßem Auge erkannt werden können: Bakterien und andere Einzeller, bestimmte Pilze, ein- und wenigzellige Algen („Mikroalgen“) und Viren. ⓘ
Form und Funktion von Pflanzen
Pflanzenkörper
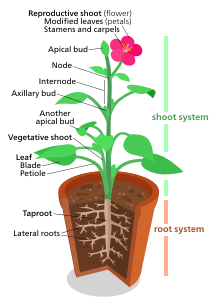
Der Pflanzenkörper besteht aus Organen, die sich in zwei große Organsysteme gliedern lassen: ein Wurzelsystem und ein Sprosssystem. Das Wurzelsystem dient der Verankerung der Pflanzen. Die Wurzeln selbst nehmen Wasser und Mineralien auf und speichern Photosyntheseprodukte. Das Sprosssystem besteht aus Stamm, Blättern und Blüten. Die Stängel halten die Blätter und richten sie zur Sonne aus, so dass die Blätter die Photosynthese betreiben können. Die Blüten sind Triebe, die für die Fortpflanzung modifiziert wurden. Sprossen bestehen aus Phytomeren, das sind funktionelle Einheiten, die aus einem Knoten mit einem oder mehreren Blättern, einem Internodium und einer oder mehreren Knospen bestehen. ⓘ
Ein Pflanzenkörper hat zwei Grundmuster (apikal-basale und radiale Achsen), die während der Embryogenese festgelegt wurden. Die Zellen und Gewebe sind entlang der Apikal-Basal-Achse von der Wurzel bis zum Spross angeordnet, während die drei Gewebesysteme (Haut, Boden und Gefäße), aus denen ein Pflanzenkörper besteht, konzentrisch um die Radialachse angeordnet sind. Das dermale Gewebesystem bildet die Epidermis (oder äußere Hülle) einer Pflanze, bei der es sich in der Regel um eine einzellige Schicht handelt, die aus Zellen besteht, die sich in drei spezialisierte Strukturen differenziert haben: Spaltöffnungen für den Gasaustausch in den Blättern, Trichome (oder Blatthaare) zum Schutz vor Insekten und Sonneneinstrahlung und Wurzelhaare zur Vergrößerung der Oberfläche und Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Das Grundgewebe bildet praktisch das gesamte Gewebe, das zwischen dem Haut- und dem Gefäßgewebe in den Sprossen und Wurzeln liegt. Es besteht aus drei Zelltypen: Parenchym-, Kollenchym- und Sklerenchymzellen. Das Gefäßgewebe schließlich besteht aus zwei Geweben: Xylem und Phloem. Das Xylem besteht aus zwei leitenden Zellen, den Tracheiden, und Gefäßelementen, während das Phloem durch das Vorhandensein von Siebröhrenelementen und Begleitzellen gekennzeichnet ist. ⓘ
Ernährung und Transport der Pflanzen

Wie alle anderen Organismen bestehen auch Pflanzen in erster Linie aus Wasser und anderen Molekülen, die lebenswichtige Elemente enthalten. Das Fehlen bestimmter Nährstoffe (oder essenzieller Elemente), von denen viele in hydroponischen Experimenten identifiziert wurden, kann das Pflanzenwachstum und die Fortpflanzung stören. Die meisten Pflanzen sind in der Lage, diese Nährstoffe aus Lösungen zu beziehen, die ihre Wurzeln im Boden umgeben. Ständiges Auslaugen und Ernten von Pflanzen kann dem Boden seine Nährstoffe entziehen, die durch den Einsatz von Düngemitteln wiederhergestellt werden können. Fleischfressende Pflanzen wie die Venusfliegenfalle können Nährstoffe durch die Verdauung anderer Gliederfüßer gewinnen, während parasitische Pflanzen wie die Mistel andere Pflanzen parasitieren können, um Wasser und Nährstoffe zu erhalten. ⓘ
Pflanzen brauchen Wasser, um Photosynthese zu betreiben, gelöste Stoffe zwischen den Organen zu transportieren, ihre Blätter durch Verdunstung zu kühlen und den inneren Druck aufrechtzuerhalten, der ihren Körper stützt. Wasser kann durch Osmose in Pflanzenzellen hinein- und hinausdiffundieren. Die Richtung der Wasserbewegung durch eine halbdurchlässige Membran wird durch das Wasserpotenzial an dieser Membran bestimmt. Wasser kann durch Aquaporine durch die Membran einer Wurzelzelle diffundieren, während gelöste Stoffe durch Ionenkanäle und Pumpen durch die Membran transportiert werden. In Gefäßpflanzen können Wasser und gelöste Stoffe über Apoplast und Symplast in das Xylem, ein Gefäßgewebe, gelangen. Im Xylem werden das Wasser und die Mineralien durch Transpiration vom Boden zu den oberirdischen Pflanzenteilen transportiert. Im Gegensatz dazu verteilt das Phloem, ein weiteres Gefäßgewebe, Kohlenhydrate (z. B. Saccharose) und andere gelöste Stoffe wie Hormone durch Verlagerung von einer Quelle (z. B. reifes Blatt oder Wurzel), in der sie produziert wurden, zu einer Senke (z. B. Wurzel, Blüte oder sich entwickelnde Frucht), in der sie verwendet und gespeichert werden. Quellen und Senken können ihre Rolle wechseln, je nach der Menge der Kohlenhydrate, die für die Ernährung anderer Organe angesammelt oder mobilisiert werden. ⓘ
Entwicklung der Pflanzen
Die Entwicklung von Pflanzen wird durch Umweltreize und pflanzeneigene Rezeptoren, Hormone und das Genom gesteuert. Darüber hinaus verfügen sie über mehrere Merkmale, die es ihnen ermöglichen, Ressourcen für Wachstum und Fortpflanzung zu erhalten, wie z. B. Meristeme, postembryonale Organbildung und differenziertes Wachstum. ⓘ
Die Entwicklung beginnt mit einem Samen, einer embryonalen Pflanze, die von einer schützenden Hülle umgeben ist. Die meisten Pflanzensamen befinden sich in der Regel in einer Ruhephase, in der die normale Aktivität des Samens unterbrochen ist. Die Keimruhe kann Wochen, Monate, Jahre und sogar Jahrhunderte dauern. Die Ruhephase wird durchbrochen, sobald die Bedingungen für das Wachstum günstig sind, und der Samen beginnt zu keimen, was als Keimung bezeichnet wird. Die Imbibition ist der erste Schritt der Keimung, bei dem Wasser vom Samen aufgenommen wird. Sobald das Wasser absorbiert ist, durchläuft der Samen metabolische Veränderungen, bei denen Enzyme aktiviert und RNA und Proteine synthetisiert werden. Sobald der Samen keimt, erhält er Kohlenhydrate, Aminosäuren und kleine Lipide, die als Bausteine für seine Entwicklung dienen. Diese Monomere werden durch die Hydrolyse von Stärke, Proteinen und Lipiden gewonnen, die entweder in den Keimblättern oder im Endosperm gespeichert sind. Die Keimung ist abgeschlossen, sobald sich die embryonalen Wurzeln, die so genannten Radicula, aus der Samenschale gelöst haben. Zu diesem Zeitpunkt wird die sich entwickelnde Pflanze als Keimling bezeichnet und ihr Wachstum wird durch ihre eigenen Photorezeptorproteine und Hormone gesteuert. ⓘ
Im Gegensatz zu Tieren, bei denen das Wachstum determiniert ist, d. h. mit dem Erreichen des Erwachsenenstadiums aufhört, ist das Wachstum von Pflanzen unbestimmt, da es sich um einen Prozess mit offenem Ende handelt, der potenziell lebenslang sein kann. Pflanzen wachsen auf zwei Arten: primär und sekundär. Beim primären Wachstum werden Sprosse und Wurzeln gebildet und verlängert. Das apikale Meristem bildet den primären Pflanzenkörper, der bei allen Samenpflanzen zu finden ist. Beim sekundären Wachstum nimmt die Dicke der Pflanze zu, da das Seitenmeristem den sekundären Pflanzenkörper hervorbringt, der bei verholzenden Eudikotyledonen wie Bäumen und Sträuchern zu finden ist. Monokotyledonen durchlaufen kein sekundäres Wachstum. Der Pflanzenkörper wird durch eine Hierarchie von Meristemen gebildet. Aus den apikalen Meristemen im Wurzel- und Sprosssystem entstehen primäre Meristeme (Protoderm, Bodenmeristem und Procambium), aus denen wiederum die drei Gewebesysteme (Dermis, Boden und Gefäße) hervorgehen. ⓘ
Reproduktion der Pflanzen

Die meisten Angiospermen (oder Blütenpflanzen) pflanzen sich sexuell fort. Ihre Blüten sind Organe, die die Fortpflanzung erleichtern, indem sie in der Regel einen Mechanismus für die Vereinigung von Spermien und Eiern bereitstellen. Blüten können zwei Arten der Bestäubung ermöglichen: Selbstbestäubung und Fremdbestäubung. Selbstbestäubung liegt vor, wenn der Pollen der Antheren auf der Narbe der gleichen Blüte oder einer anderen Blüte der gleichen Pflanze abgelagert wird. Unter Fremdbestäubung versteht man die Übertragung von Pollen von der Anthere einer Blüte auf die Narbe einer anderen Blüte einer anderen Art. Die Selbstbestäubung erfolgt bei Blüten, bei denen Staubgefäß und Fruchtblatt gleichzeitig reifen und so angeordnet sind, dass der Pollen auf der Narbe der Blüte landen kann. Diese Bestäubung erfordert keine Investition der Pflanze, um Nektar und Pollen als Nahrung für die Bestäuber bereitzustellen. ⓘ
Reaktionen der Pflanze
Wie Tiere produzieren auch Pflanzen Hormone in einem Teil ihres Körpers, um Zellen in einem anderen Teil zu signalisieren, dass sie reagieren sollen. Die Reifung der Früchte und der Verlust der Blätter im Winter werden zum Teil durch die Produktion des Gases Ethylen durch die Pflanze gesteuert. Stress durch Wasserverlust, Veränderungen in der Luftchemie oder Verdrängung durch andere Pflanzen kann zu Veränderungen in der Funktionsweise einer Pflanze führen. Diese Veränderungen können durch genetische, chemische und physikalische Faktoren beeinflusst werden. ⓘ
Um zu funktionieren und zu überleben, produzieren Pflanzen eine Vielzahl von chemischen Verbindungen, die in anderen Organismen nicht vorkommen. Da sie sich nicht bewegen können, müssen sich Pflanzen auch chemisch gegen Pflanzenfresser, Krankheitserreger und die Konkurrenz durch andere Pflanzen verteidigen. Zu diesem Zweck produzieren sie Giftstoffe und übel riechende oder schmeckende Chemikalien. Andere Verbindungen schützen die Pflanzen vor Krankheiten, ermöglichen das Überleben bei Trockenheit und bereiten die Pflanzen auf die Ruhephase vor, während wieder andere Verbindungen dazu dienen, Bestäuber oder Pflanzenfresser anzulocken, um reife Samen zu verbreiten. ⓘ
Viele Pflanzenorgane enthalten verschiedene Arten von Photorezeptorproteinen, die jeweils sehr spezifisch auf bestimmte Wellenlängen des Lichts reagieren. Die Photorezeptorproteine leiten Informationen weiter, z. B. ob es Tag oder Nacht ist, die Dauer des Tages, die Intensität des vorhandenen Lichts und die Lichtquelle. Sprossen wachsen in der Regel zum Licht hin, während Wurzeln vom Licht wegwachsen; diese Reaktionen sind als Phototropismus bzw. Skototropismus bekannt. Diese Reaktionen werden durch lichtempfindliche Pigmente wie Phototropine und Phytochrome und das Pflanzenhormon Auxin hervorgerufen. Viele blühende Pflanzen blühen zum richtigen Zeitpunkt, weil sie über lichtempfindliche Verbindungen verfügen, die auf die Länge der Nacht reagieren, ein Phänomen, das als Photoperiodismus bezeichnet wird. ⓘ
Neben dem Licht können Pflanzen auch auf andere Arten von Reizen reagieren. So können Pflanzen beispielsweise die Richtung der Schwerkraft wahrnehmen, um sich richtig zu orientieren. Sie können auf mechanische Reize reagieren. ⓘ
Form und Funktion von Tieren
Allgemeine Merkmale

Die Zellen in jedem tierischen Körper sind von einer interstitiellen Flüssigkeit umgeben, die die Umgebung der Zelle bildet. Diese Flüssigkeit und alle ihre Eigenschaften (z. B. Temperatur, Ionenzusammensetzung) können als die innere Umgebung des Tieres bezeichnet werden, die im Gegensatz zur äußeren Umgebung steht, die die Außenwelt des Tieres umfasst. Tiere können entweder als Regulatoren oder als Konformisten klassifiziert werden. Tiere wie Säugetiere und Vögel gehören zu den Regulatoren, da sie in der Lage sind, eine konstante innere Umgebung, wie z. B. die Körpertemperatur, aufrechtzuerhalten, obwohl sich ihre Umgebung verändert. Diese Tiere werden auch als Homöothermen bezeichnet, da sie eine Thermoregulation aufweisen, indem sie ihre innere Körpertemperatur konstant halten. Im Gegensatz dazu sind Tiere wie Fische und Frösche Konformisten, da sie ihre innere Umgebung (z. B. ihre Körpertemperatur) an ihre äußere Umgebung anpassen. Diese Tiere werden auch als Poikilothermen oder Ektothermen bezeichnet, da sie ihre Körpertemperatur an ihre äußere Umgebung anpassen können. In Bezug auf den Energieverbrauch ist die Regulierung kostspieliger als die Anpassung, da ein Tier mehr Energie aufwendet, um eine konstante innere Umgebung aufrechtzuerhalten, z. B. durch Erhöhung des Grundumsatzes, d. h. der Energieverbrauchsrate. In ähnlicher Weise ist Homöothermie kostspieliger als Poikilothermie. Unter Homöostase versteht man die Stabilität des inneren Milieus eines Tieres, die durch negative Rückkopplungsschleifen aufrechterhalten wird. ⓘ
Die Körpergröße von Landtieren variiert von Art zu Art, aber ihr Energieverbrauch hängt nicht linear von ihrer Größe ab. Mäuse zum Beispiel können im Verhältnis zu ihrem Gewicht dreimal mehr Nahrung aufnehmen als Kaninchen, da der Grundumsatz pro Gewichtseinheit bei Mäusen höher ist als bei Kaninchen. Auch körperliche Aktivität kann den Stoffwechsel eines Tieres erhöhen. Wenn ein Tier rennt, steigt sein Stoffwechsel linear mit der Geschwindigkeit an. Bei Tieren, die schwimmen oder fliegen, ist die Beziehung jedoch nicht linear. Wenn ein Fisch schneller schwimmt, stößt er auf einen größeren Wasserwiderstand, so dass seine Stoffwechselrate exponentiell ansteigt. Bei Vögeln hingegen ist das Verhältnis zwischen Fluggeschwindigkeit und Stoffwechselrate U-förmig. Bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten muss ein Vogel einen hohen Stoffwechsel aufrechterhalten, um in der Luft zu bleiben. Mit zunehmender Fluggeschwindigkeit sinkt sein Stoffwechsel mit Hilfe der Luft, die schnell über seine Flügel strömt. Wenn er jedoch seine Geschwindigkeit weiter erhöht, steigt sein hoher Stoffwechselwert wieder an, da er sich bei schnellen Fluggeschwindigkeiten mehr anstrengt. Der Grundumsatz kann anhand der Wärmeproduktion eines Tieres gemessen werden. ⓘ
Wasser- und Salzhaushalt

Die Körperflüssigkeiten eines Tieres haben drei Eigenschaften: osmotischer Druck, ionische Zusammensetzung und Volumen. Der osmotische Druck bestimmt die Richtung der Wasserdiffusion (oder Osmose), die sich von einem Bereich mit niedrigem osmotischem Druck (Gesamtkonzentration der gelösten Stoffe) zu einem Bereich mit hohem osmotischem Druck (Gesamtkonzentration der gelösten Stoffe) bewegt. Wassertiere sind im Hinblick auf die Zusammensetzung ihrer Körperflüssigkeiten und ihre Umgebung sehr unterschiedlich. So haben beispielsweise die meisten wirbellosen Tiere im Meer Körperflüssigkeiten, die mit dem Meerwasser isosmotisch sind. Im Gegensatz dazu haben Knochenfische im Meer Körperflüssigkeiten, die hyposmotisch zum Meerwasser sind. Süßwassertiere schließlich haben Körperflüssigkeiten, die gegenüber Süßwasser hyperosmotisch sind. Typische Ionen in den Körperflüssigkeiten der Tiere sind Natrium, Kalium, Kalzium und Chlorid. Das Volumen der Körperflüssigkeiten kann durch Ausscheidungen reguliert werden. Wirbeltiere haben Nieren, Ausscheidungsorgane, die aus winzigen röhrenförmigen Strukturen, den Nephronen, bestehen und aus dem Blutplasma Urin bilden. Die Hauptaufgabe der Nieren besteht darin, die Zusammensetzung und das Volumen des Blutplasmas zu regulieren, indem sie selektiv Stoffe aus dem Blutplasma selbst entfernen. Die Fähigkeit von Trockenheitstieren wie Kängururatten, den Wasserverlust zu minimieren, indem sie Urin produzieren, der 10-20 Mal konzentrierter ist als ihr Blutplasma, ermöglicht es ihnen, sich an Wüstenumgebungen anzupassen, in denen nur sehr wenig Niederschlag fällt. ⓘ
Ernährung und Verdauung

Tiere sind Heterotrophe, d. h. sie ernähren sich von anderen Organismen, um Energie und organische Verbindungen zu gewinnen. Sie können sich auf drei Arten ernähren: Sie suchen gezielt nach sichtbaren Nahrungsobjekten, sammeln winzige Nahrungspartikel und sind bei der Deckung ihres kritischen Nahrungsbedarfs auf Mikroben angewiesen. Die in der Nahrung gespeicherte Energiemenge kann anhand der Wärmemenge (gemessen in Kalorien oder Kilojoule) quantifiziert werden, die bei der Verbrennung der Nahrung in Gegenwart von Sauerstoff freigesetzt wird. Wenn ein Tier Nahrung zu sich nimmt, die einen Überschuss an chemischer Energie enthält, speichert es den größten Teil dieser Energie in Form von Lipiden für eine spätere Verwendung und einen Teil dieser Energie als Glykogen für eine unmittelbarere Verwendung (z. B. zur Deckung des Energiebedarfs des Gehirns). Die Moleküle in der Nahrung sind chemische Bausteine, die für Wachstum und Entwicklung benötigt werden. Zu diesen Molekülen gehören Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Auch Vitamine und Mineralien (z. B. Kalzium, Magnesium, Natrium und Phosphor) sind wichtig. Das Verdauungssystem, das in der Regel aus einem röhrenförmigen Trakt besteht, der sich vom Mund bis zum Anus erstreckt, ist an der Aufspaltung (oder Verdauung) der Nahrung in kleine Moleküle beteiligt, die kurz nach der Nahrungsaufnahme peristaltisch durch das Darmlumen wandern. Diese kleinen Nahrungsmoleküle werden dann aus dem Lumen in das Blut aufgenommen, wo sie dann als Bausteine (z. B. Aminosäuren) oder Energiequellen (z. B. Glukose) an den Rest des Körpers verteilt werden. ⓘ
Zusätzlich zu ihrem Verdauungstrakt verfügen Wirbeltiere über Drüsen wie Leber und Bauchspeicheldrüse, die Teil ihres Verdauungssystems sind. Die Verarbeitung der Nahrung beginnt bei diesen Tieren im Vorderdarm, der den Mund, die Speiseröhre und den Magen umfasst. Die mechanische Verdauung der Nahrung beginnt im Mund, wobei die Speiseröhre als Durchgang für die Nahrung zum Magen dient, wo sie gespeichert und (durch die Magensäure) für die weitere Verarbeitung zersetzt wird. Nach dem Verlassen des Magens gelangt die Nahrung in den Mitteldarm, den ersten Teil des Darms (oder Dünndarms bei Säugetieren), in dem die Verdauung und Absorption stattfindet. Nahrung, die nicht absorbiert wird, wird als unverdaulicher Abfall (oder Kot) im Hinterdarm, dem zweiten Teil des Darms (oder Dickdarms bei Säugetieren), gespeichert. Der Hinterdarm vervollständigt dann die Rückresorption von benötigtem Wasser und Salz, bevor er den Kot über den Enddarm ausscheidet. ⓘ
Atmung

Das Atmungssystem besteht aus spezifischen Organen und Strukturen, die dem Gasaustausch bei Tieren dienen. Die Anatomie und Physiologie, die dies ermöglichen, sind sehr unterschiedlich und hängen von der Größe des Organismus, der Umgebung, in der er lebt, und seiner Evolutionsgeschichte ab. Bei Landtieren ist die Atmungsoberfläche als Auskleidung der Lunge verinnerlicht. Der Gasaustausch in der Lunge findet in Millionen von kleinen Luftsäcken statt, die bei Säugetieren und Reptilien als Alveolen und bei Vögeln als Vorhöfe bezeichnet werden. Diese mikroskopisch kleinen Luftsäcke sind sehr gut durchblutet, so dass die Luft in engen Kontakt mit dem Blut kommt. Diese Luftsäcke kommunizieren mit der äußeren Umgebung über ein System von Atemwegen oder hohlen Röhren, von denen die größte die Luftröhre ist, die sich in der Mitte des Brustkorbs in die beiden Hauptbronchien verzweigt. Diese münden in die Lunge, wo sie sich in immer enger werdende sekundäre und tertiäre Bronchien verzweigen, die sich in zahlreiche kleinere Röhren, die Bronchiolen, aufteilen. Bei Vögeln werden die Bronchiolen als Parabronchi bezeichnet. Die Bronchiolen oder Parabronchi münden bei Säugetieren im Allgemeinen in die mikroskopisch kleinen Lungenbläschen und bei Vögeln in die Vorhöfe. Beim Atmen muss Luft aus der Umgebung in die Alveolen oder Vorhöfe gepumpt werden, wozu die Atmungsmuskeln eingesetzt werden. ⓘ
Kreislauf

Ein Kreislaufsystem besteht in der Regel aus einer Muskelpumpe (z. B. einem Herz), einer Flüssigkeit (Blut) und einem System von Blutgefäßen, die diese Flüssigkeit transportieren. Seine Hauptaufgabe ist der Transport von Blut und anderen Stoffen zu und von den Zellen und Geweben. Es gibt zwei Arten von Kreislaufsystemen: offene und geschlossene. Bei offenen Kreislaufsystemen tritt das Blut aus den Blutgefäßen aus, während es durch den Körper zirkuliert, während es bei geschlossenen Kreislaufsystemen in den Blutgefäßen eingeschlossen ist, während es zirkuliert. Offene Kreislaufsysteme können bei wirbellosen Tieren wie Gliederfüßern (z. B. Insekten, Spinnen und Hummern) beobachtet werden, während geschlossene Kreislaufsysteme bei Wirbeltieren wie Fischen, Amphibien und Säugetieren zu finden sind. Der Kreislauf bei Tieren findet zwischen zwei Arten von Geweben statt: dem Körpergewebe und den Atmungsorganen (oder der Lunge). Systemische Gewebe sind alle Gewebe und Organe, aus denen der Körper eines Tieres besteht, mit Ausnahme der Atmungsorgane. Systemische Gewebe nehmen Sauerstoff auf, geben aber Kohlendioxid an das Blut ab, während die Atmungsorgane Kohlendioxid aufnehmen, aber Sauerstoff an das Blut abgeben. Bei Vögeln und Säugetieren sind das systemische und das pulmonale System in Reihe geschaltet. ⓘ
Im Kreislaufsystem spielt das Blut eine wichtige Rolle, denn es ist das Transportmittel für Sauerstoff, Kohlendioxid, Nährstoffe, Hormone, Stoffe des Immunsystems, Wärme, Abfallstoffe und andere Güter. Bei Ringelwürmern wie Regenwürmern und Blutegeln wird das Blut durch peristaltische Kontraktionswellen der Herzmuskeln, die die Blutgefäße bilden, transportiert. Andere Tiere, wie Krebstiere (z. B. Krebse und Hummer), haben mehr als ein Herz, um das Blut durch ihren Körper zu befördern. Wirbeltierherzen haben mehrere Kammern und sind in der Lage, Blut zu pumpen, wenn sich ihre Herzkammern bei jedem Herzzyklus zusammenziehen, wodurch das Blut durch die Blutgefäße befördert wird. Obwohl Wirbeltierherzen myogen sind, kann ihre Kontraktionsrate (oder Herzfrequenz) durch neuronale Eingaben vom autonomen Nervensystem des Körpers moduliert werden. ⓘ
Muskeln und Bewegung
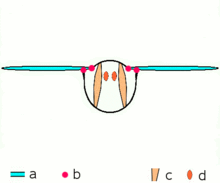
Bei Wirbeltieren besteht das Muskelsystem aus Skelettmuskeln, glatten Muskeln und Herzmuskeln. Sie ermöglicht die Bewegung des Körpers, die Aufrechterhaltung der Körperhaltung und den Blutkreislauf im Körper. Zusammen mit dem Skelettsystem bildet sie das muskuloskelettale System, das für die Bewegung der Wirbeltiere verantwortlich ist. Skelettmuskelkontraktionen sind neurogen, da sie einen synaptischen Input von Motoneuronen benötigen. Ein einziges Motoneuron ist in der Lage, mehrere Muskelfasern zu erregen, so dass sich die Fasern gleichzeitig zusammenziehen. Nach der Erregung gleiten die Proteinfilamente in jeder Skelettmuskelfaser aneinander vorbei, um eine Kontraktion zu erzeugen, was durch die Theorie der gleitenden Filamente erklärt wird. Die erzeugte Kontraktion kann als Zuckung, Summation oder Tetanus beschrieben werden, je nach Häufigkeit der Aktionspotentiale. Im Gegensatz zur Skelettmuskulatur sind die Kontraktionen der glatten und der Herzmuskulatur myogen, da sie von den glatten oder Herzmuskelzellen selbst und nicht von einem Motoneuron ausgelöst werden. Dennoch kann die Stärke ihrer Kontraktionen durch Eingaben des autonomen Nervensystems moduliert werden. Die Mechanismen der Kontraktion sind in allen drei Muskelgeweben ähnlich. ⓘ
Bei wirbellosen Tieren wie Regenwürmern und Blutegeln bilden zirkuläre und longitudinale Muskelzellen die Körperwand dieser Tiere und sind für ihre Bewegung verantwortlich. Bei einem Regenwurm, der sich zum Beispiel durch den Boden bewegt, kontrahieren die zirkulären und die längsgerichteten Muskeln wechselseitig, während die Coelomflüssigkeit als Hydroskelett dient, indem sie die Spannkraft des Regenwurms aufrechterhält. Andere Tiere wie Weichtiere und Fadenwürmer besitzen schräg gestreifte Muskeln, die Bänder aus dicken und dünnen Fäden enthalten, die schraubenförmig und nicht quer angeordnet sind, wie bei den Skelett- oder Herzmuskeln der Wirbeltiere. Fortgeschrittene Insekten wie Wespen, Fliegen, Bienen und Käfer besitzen asynchrone Muskeln, die bei diesen Tieren die Flugmuskeln bilden. Diese Flugmuskeln werden oft als fibrilläre Muskeln bezeichnet, weil sie dicke und auffällige Myofibrillen enthalten. ⓘ
Das Nervensystem

Die meisten mehrzelligen Tiere verfügen über ein Nervensystem, das es ihnen ermöglicht, ihre Umgebung wahrzunehmen und auf sie zu reagieren. Ein Nervensystem ist ein Netzwerk von Zellen, das sensorische Informationen verarbeitet und Verhaltensweisen erzeugt. Auf zellulärer Ebene wird das Nervensystem durch das Vorhandensein von Neuronen definiert, d. h. Zellen, die auf die Verarbeitung von Informationen spezialisiert sind. Sie können Informationen an Kontaktstellen, den Synapsen, übertragen oder empfangen. Genauer gesagt können Neuronen Nervenimpulse (oder Aktionspotenziale) leiten, die sich entlang ihrer dünnen Fasern, den Axonen, ausbreiten. Diese können dann über elektrische Synapsen direkt an eine benachbarte Zelle übertragen werden oder an chemischen Synapsen die Freisetzung von Chemikalien, den Neurotransmittern, bewirken. Nach der Natriumtheorie können diese Aktionspotenziale durch die erhöhte Durchlässigkeit der Zellmembran des Neurons für Natriumionen erzeugt werden. Zellen wie Neuronen oder Muskelzellen können erregt oder gehemmt werden, wenn sie ein Signal von einem anderen Neuron erhalten. Die Verbindungen zwischen Neuronen können neuronale Bahnen, neuronale Schaltkreise und größere Netzwerke bilden, die die Wahrnehmung der Welt durch einen Organismus erzeugen und sein Verhalten bestimmen. Neben den Neuronen enthält das Nervensystem auch andere spezialisierte Zellen, die als Glia- oder Gliazellen bezeichnet werden und die strukturelle und metabolische Unterstützung bieten. ⓘ
Bei Wirbeltieren besteht das Nervensystem aus dem zentralen Nervensystem (ZNS), zu dem das Gehirn und das Rückenmark gehören, und dem peripheren Nervensystem (PNS), das aus den Nerven besteht, die das ZNS mit allen anderen Teilen des Körpers verbinden. Nerven, die Signale aus dem ZNS übertragen, werden als motorische Nerven oder efferente Nerven bezeichnet, während die Nerven, die Informationen aus dem Körper an das ZNS weiterleiten, als sensorische Nerven oder afferente Nerven bezeichnet werden. Bei den Spinalnerven handelt es sich um Mischnerven, die beide Funktionen erfüllen. Das PNS ist in drei separate Teilsysteme unterteilt: das somatische, das autonome und das enterische Nervensystem. Die somatischen Nerven vermitteln die willkürliche Bewegung. Das autonome Nervensystem wird weiter unterteilt in das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Der Sympathikus wird in Notfällen aktiviert, um Energie zu mobilisieren, während der Parasympathikus aktiviert wird, wenn sich der Organismus in einem entspannten Zustand befindet. Das enterische Nervensystem dient der Steuerung des Magen-Darm-Systems. Sowohl das autonome als auch das enterische Nervensystem funktionieren unwillkürlich. Nerven, die direkt aus dem Gehirn austreten, werden als Hirnnerven bezeichnet, während diejenigen, die aus dem Rückenmark austreten, Spinalnerven genannt werden. ⓘ
Viele Tiere haben Sinnesorgane, mit denen sie ihre Umgebung wahrnehmen können. Diese Sinnesorgane enthalten Sinnesrezeptoren, d. h. sensorische Neuronen, die Reize in elektrische Signale umwandeln. Mechanorezeptoren, die beispielsweise in Haut, Muskeln und Hörorganen zu finden sind, erzeugen Aktionspotenziale als Reaktion auf Druckveränderungen. Photorezeptorzellen wie Stäbchen und Zapfen, die Teil der Netzhaut von Wirbeltieren sind, können auf bestimmte Wellenlängen des Lichts reagieren. Chemorezeptoren erkennen Chemikalien im Mund (Geschmack) oder in der Luft (Geruch). ⓘ
Hormonelle Steuerung
Hormone sind Signalmoleküle, die über das Blut zu entfernten Organen transportiert werden, um deren Funktion zu regulieren. Hormone werden von inneren Drüsen ausgeschüttet, die Teil des endokrinen Systems eines Tieres sind. Bei Wirbeltieren ist der Hypothalamus das neuronale Kontrollzentrum für alle endokrinen Systeme. Beim Menschen sind die wichtigsten endokrinen Drüsen die Schilddrüse und die Nebennieren. Viele andere Organe, die Teil anderer Körpersysteme sind, haben sekundäre endokrine Funktionen, darunter Knochen, Nieren, Leber, Herz und Keimdrüsen. Die Nieren sezernieren zum Beispiel das endokrine Hormon Erythropoietin. Hormone können Aminosäurekomplexe, Steroide, Eicosanoide, Leukotriene oder Prostaglandine sein. Das endokrine System kann sowohl mit exokrinen Drüsen, die Hormone nach außen abgeben, als auch mit parakrinen Signalen zwischen Zellen über eine relativ kurze Distanz verglichen werden. Endokrine Drüsen haben keine Ausführungsgänge, sind vaskulär und haben in der Regel intrazelluläre Vakuolen oder Granula, die ihre Hormone speichern. Im Gegensatz dazu sind exokrine Drüsen, wie Speicheldrüsen, Schweißdrüsen und Drüsen im Magen-Darm-Trakt, in der Regel weniger gefäßreich und haben Kanäle oder ein hohles Lumen. ⓘ
Fortpflanzung bei Tieren

Tiere können sich auf zwei Arten fortpflanzen: ungeschlechtlich oder geschlechtlich. Nahezu alle Tiere pflanzen sich in irgendeiner Form sexuell fort. Sie produzieren haploide Gameten durch Meiose. Die kleineren, beweglichen Geschlechtszellen sind Spermien, die größeren, unbeweglichen Geschlechtszellen sind Eizellen. Diese verschmelzen zu Zygoten, die sich durch Mitose zu einer Hohlkugel, der Blastula, entwickeln. Bei Schwämmen schwimmen die Blastula-Larven zu einem neuen Standort, setzen sich am Meeresboden fest und entwickeln sich zu einem neuen Schwamm. Bei den meisten anderen Gruppen durchläuft die Blastula eine kompliziertere Umstrukturierung. Zunächst invaginiert sie und bildet eine Gastrula mit einer Verdauungskammer und zwei getrennten Keimschichten, einem äußeren Ektoderm und einem inneren Endoderm. In den meisten Fällen entwickelt sich dazwischen noch eine dritte Keimschicht, das Mesoderm. Diese Keimschichten differenzieren sich dann zu Geweben und Organen. Einige Tiere sind zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung fähig, die oft zu einem genetischen Klon des Elternteils führt. Dies kann durch Fragmentierung geschehen, durch Knospung, wie bei Hydra und anderen Nesseltieren, oder durch Parthenogenese, bei der fruchtbare Eier ohne Paarung produziert werden, wie bei Blattläusen. ⓘ
Entwicklung von Tieren

Die Entwicklung von Tieren beginnt mit der Bildung einer Zygote, die durch die Verschmelzung von Spermium und Eizelle während der Befruchtung entsteht. Die Zygote durchläuft mehrere schnelle Runden mitotischer Zellteilungen, die als Spaltung bezeichnet werden und einen Ball ähnlicher Zellen, die Blastula, bilden. Es kommt zur Gastrulation, bei der die Zellmasse durch morphogenetische Bewegungen in drei Keimschichten umgewandelt wird, die das Ektoderm, Mesoderm und Endoderm umfassen. ⓘ
Das Ende der Gastrulation signalisiert den Beginn der Organogenese, wobei die drei Keimschichten die inneren Organe des Organismus bilden. Die Zellen jeder der drei Keimschichten durchlaufen eine Differenzierung, einen Prozess, bei dem weniger spezialisierte Zellen durch die Expression einer bestimmten Gruppe von Genen zu mehr spezialisierten Zellen werden. Die zelluläre Differenzierung wird durch extrazelluläre Signale wie Wachstumsfaktoren beeinflusst, die mit benachbarten Zellen ausgetauscht werden, was als juxtrakrine Signalgebung bezeichnet wird, oder mit benachbarten Zellen über kurze Distanzen, was als parakrine Signalgebung bezeichnet wird. Intrazelluläre Signale, die von einer Zelle selbst ausgesendet werden (autokrine Signalübertragung), spielen ebenfalls eine Rolle bei der Organbildung. Diese Signalwege ermöglichen die Umlagerung von Zellen und sorgen dafür, dass sich Organe an bestimmten Stellen im Organismus bilden. ⓘ
Das Immunsystem

Das Immunsystem ist ein Netzwerk biologischer Prozesse, das eine Vielzahl von Krankheitserregern aufspürt und auf sie reagiert. Bei vielen Arten gibt es zwei große Untersysteme des Immunsystems. Das angeborene Immunsystem bietet eine vorkonfigurierte Reaktion auf eine breite Palette von Situationen und Reizen. Das adaptive Immunsystem liefert eine maßgeschneiderte Antwort auf jeden Reiz, indem es lernt, Moleküle zu erkennen, denen es zuvor begegnet ist. Beide nutzen Moleküle und Zellen, um ihre Funktionen zu erfüllen. ⓘ
Fast alle Organismen haben eine Art von Immunsystem. Bakterien haben ein rudimentäres Immunsystem in Form von Enzymen, die vor Virusinfektionen schützen. Andere grundlegende Immunmechanismen haben sich in alten Pflanzen und Tieren entwickelt und sind in ihren modernen Nachfahren erhalten geblieben. Zu diesen Mechanismen gehören die Phagozytose, antimikrobielle Peptide, so genannte Defensine, und das Komplementsystem. Wirbeltiere mit Kiefer, einschließlich des Menschen, verfügen über noch ausgefeiltere Abwehrmechanismen, darunter die Fähigkeit, sich anzupassen, um Krankheitserreger effizienter zu erkennen. Die adaptive (oder erworbene) Immunität schafft ein immunologisches Gedächtnis, das bei späteren Begegnungen mit demselben Krankheitserreger zu einer verstärkten Reaktion führt. Dieser Prozess der erworbenen Immunität ist die Grundlage der Impfung. ⓘ
Verhalten der Tiere

Verhaltensweisen spielen eine zentrale Rolle in der Interaktion der Tiere untereinander und mit ihrer Umwelt. Sie sind in der Lage, ihre Muskeln einzusetzen, um sich einander zu nähern, zu singen, Schutz zu suchen und zu wandern. Das Nervensystem eines Tieres aktiviert und koordiniert seine Verhaltensweisen. Feste Handlungsmuster sind zum Beispiel genetisch festgelegte und stereotype Verhaltensweisen, die ohne Lernen auftreten. Diese Verhaltensweisen werden vom Nervensystem gesteuert und können recht ausgeklügelt sein. Ein Beispiel dafür ist das Picken der Küken von Seemöwen nach dem roten Punkt auf dem Schnabel ihrer Mutter. Andere Verhaltensweisen, die sich als Ergebnis der natürlichen Selektion herausgebildet haben, sind Nahrungssuche, Paarung und Altruismus. Zusätzlich zu den entwickelten Verhaltensweisen haben die Tiere die Fähigkeit entwickelt, zu lernen, indem sie ihre Verhaltensweisen aufgrund früher individueller Erfahrungen ändern. ⓘ
Die Verhaltensbiologie erforscht das Verhalten der Tiere und des Menschen. Sie beschreibt das Verhalten, stellt Vergleiche zwischen Individuen und Arten an und versucht, das Entstehen bestimmter Verhaltensweisen im Verlauf der Stammesgeschichte zu erklären, also den „Nutzen“ für das Individuum. ⓘ
Ökologie
Das Fachgebiet Ökologie (auch Umweltbiologie) setzt sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Organismen und den abiotischen und biotischen Faktoren ihres Lebensraumes auf verschiedenen Organisationsebenen auseinander.
- Individuen: Die Autökologie betrachtet vor allem Auswirkungen der abiotischen Faktoren wie Licht, Temperatur, Wasserversorgung oder jahreszeitlichen Wandel auf das Individuum. Biologische Disziplinen, die diese Ebene ebenfalls betrachten, sind beispielsweise die Anthropologie, Zoologie, Botanik und Verhaltensbiologie.
- Populationen (Demökologie):

Eine Population ist eine Fortpflanzungsgemeinschaft innerhalb einer Art in einem zeitlich und räumlich begrenzten Gebiet. Die Populationsökologie betrachtet vor allem die Dynamik der Populationen eines Lebensraumes auf Grund der Veränderungen der Geburten- und Sterberate, durch Veränderungen im Nahrungsangebot oder abiotischer Umweltfaktoren. Diese Ebene wird auch von der Verhaltensbiologie und der Soziobiologie untersucht. ⓘ
Im Zusammenhang mit der Beschreibung und Untersuchung sozialer Verbände wie Herden oder Rudel können auch die auf den Menschen angewandten Gesellschaftswissenschaften gesehen werden. ⓘ
- Biozönosen (Synökologie): Sie stellen Gemeinschaften von Organismen dar. Pflanzen, Tiere, Pilze, Einzeller und Bakterien sind in einem Ökosystem meist voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. Sie sind Teil von Stoffkreisläufen in ihrem Lebensraum bis hin zu den globalen Stoffkreisläufen wie dem Kohlenstoffzyklus. ⓘ
Die Lebewesen können sich positiv (z. B. Symbiose), negativ (z. B. Fressfeinde, Parasitismus) oder einfach gar nicht beeinflussen. ⓘ
Lebensgemeinschaft (Biozönose) und Lebensraum (Biotop) bilden zusammen ein Ökosystem. ⓘ
- Die Landschaftsökologie ist auf die räumliche Ausprägung ökologischer Zusammenhänge und Regelkreise gerichtet. Sie erforscht das Zusammenwirken von Biodiversität und Geodiversität auf der Ebene der daraus resultierenden Landschaftsdiversität.
- In der Humanökologie werden im Besonderen die wechselseitigen Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt gerückt. ⓘ
Biologische Disziplinen, die sich mit Ökosystemen beschäftigen (Beispiele):
- Biogeografie, Biozönologie
- Ökologie, Chorologie, Geobotanik, Pflanzensoziologie ⓘ
Da die Evolution der Organismen zu einer Anpassung an eine bestimmte Umwelt führen kann, besteht ein intensiver Austausch zwischen beiden Fachdisziplinen, was insbesondere in der Disziplin der Evolutionsökologie zum Ausdruck kommt. ⓘ
Ökosysteme

Ökologie ist die Lehre von der Verteilung und Häufigkeit des Lebens, der Wechselwirkung zwischen Organismen und ihrer Umwelt. Die Gemeinschaft der lebenden (biotischen) Organismen in Verbindung mit den nicht lebenden (abiotischen) Bestandteilen ihrer Umwelt (z. B. Wasser, Licht, Strahlung, Temperatur, Feuchtigkeit, Atmosphäre, Säuregehalt und Boden) wird als Ökosystem bezeichnet. Diese biotischen und abiotischen Komponenten sind durch Nährstoffkreisläufe und Energieflüsse miteinander verbunden. Die Energie der Sonne gelangt durch Photosynthese in das System und wird in das Pflanzengewebe eingebaut. Indem sie sich von Pflanzen und voneinander ernähren, spielen die Tiere eine wichtige Rolle bei der Bewegung von Materie und Energie durch das System. Sie beeinflussen auch die Menge der vorhandenen pflanzlichen und mikrobiellen Biomasse. Durch den Abbau toter organischer Stoffe geben Zersetzer Kohlenstoff an die Atmosphäre ab und erleichtern den Nährstoffkreislauf, indem sie die in der toten Biomasse gespeicherten Nährstoffe wieder in eine Form umwandeln, die von Pflanzen und anderen Mikroben leicht genutzt werden kann. ⓘ
Die physikalische Umwelt der Erde wird durch die Sonnenenergie und die Topographie geformt. Aufgrund der Kugelform der Erde und ihrer axialen Neigung variiert die Menge der Sonnenenergie in Raum und Zeit. Die Schwankungen des solaren Energieeintrags bestimmen das Wetter und die Klimamuster. Das Wetter ist die tägliche Temperatur- und Niederschlagsaktivität, während das Klima der langfristige Durchschnitt des Wetters ist, typischerweise gemittelt über einen Zeitraum von 30 Jahren. Variationen in der Topografie führen ebenfalls zu Umweltheterogenität. Auf der windzugewandten Seite eines Berges beispielsweise steigt die Luft auf und kühlt sich ab, wobei das Wasser von der gasförmigen in die flüssige oder feste Form übergeht, was zu Niederschlägen wie Regen oder Schnee führt. In feuchten Umgebungen kann daher eine üppige Vegetation gedeihen. Im Gegensatz dazu sind die Bedingungen auf der Leeseite eines Gebirges eher trocken, weil es dort keine Niederschläge gibt, da die Luft absteigt und sich erwärmt und die Feuchtigkeit als Wasserdampf in der Atmosphäre bleibt. Temperatur und Niederschlag sind die wichtigsten Faktoren, die terrestrische Biome prägen. ⓘ
Populationen

Eine Population ist die Anzahl von Organismen derselben Art, die ein Gebiet bewohnen und sich von Generation zu Generation fortpflanzen. Ihre Fülle kann anhand der Bevölkerungsdichte gemessen werden, d. h. der Anzahl der Individuen pro Flächeneinheit (z. B. Land oder Baum) oder Volumen (z. B. Meer oder Luft). Da es in der Regel nicht möglich ist, alle Individuen einer großen Population zu zählen, um deren Größe zu bestimmen, kann die Populationsgröße durch Multiplikation der Populationsdichte mit der Fläche oder dem Volumen geschätzt werden. Das Bevölkerungswachstum in kurzfristigen Zeiträumen kann mit Hilfe der Gleichung für die Bevölkerungswachstumsrate bestimmt werden, die die Geburten-, Sterbe- und Einwanderungsraten berücksichtigt. Längerfristig verlangsamt sich das exponentielle Wachstum einer Bevölkerung tendenziell, wenn sie ihre Tragfähigkeit erreicht, was mit der logistischen Gleichung modelliert werden kann. Die Tragfähigkeit einer Umwelt ist die maximale Populationsgröße einer Art, die in dieser spezifischen Umwelt unter Berücksichtigung der verfügbaren Nahrung, des Lebensraums, des Wassers und anderer Ressourcen aufrechterhalten werden kann. Die Tragfähigkeit einer Population kann durch sich ändernde Umweltbedingungen beeinflusst werden, z. B. durch Veränderungen in der Verfügbarkeit von Ressourcen und den Kosten für ihre Erhaltung. In Bezug auf die menschliche Bevölkerung haben neue Technologien wie die Grüne Revolution dazu beigetragen, dass die Tragfähigkeit der Erde für die Menschen im Laufe der Zeit gestiegen ist, was die versuchten Vorhersagen über den bevorstehenden Bevölkerungsrückgang - die berühmteste davon stammt von Thomas Malthus aus dem 18. ⓘ
Gemeinschaften
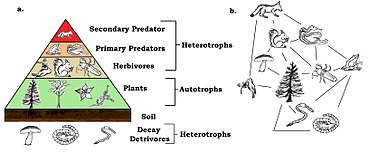
Eine Gemeinschaft ist eine Gruppe von Populationen zweier oder mehrerer verschiedener Arten, die zur gleichen Zeit dasselbe geografische Gebiet bewohnen. Eine biologische Wechselwirkung ist die Wirkung, die ein Paar von Organismen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben, aufeinander hat. Dabei kann es sich entweder um dieselbe Art (intraspezifische Wechselwirkungen) oder um verschiedene Arten (interspezifische Wechselwirkungen) handeln. Diese Auswirkungen können kurzfristig sein, wie z. B. Bestäubung und Prädation, oder langfristig; beide haben oft einen starken Einfluss auf die Entwicklung der beteiligten Arten. Eine langfristige Interaktion wird als Symbiose bezeichnet. Symbiosen reichen von Gegenseitigkeit, die für beide Partner von Vorteil ist, bis hin zu Konkurrenz, die beiden Partnern schadet. ⓘ
Jede Art nimmt als Konsument, Ressource oder beides an den Interaktionen zwischen Konsumenten und Ressourcen teil, die den Kern der Nahrungsketten oder Nahrungsnetze bilden. In jedem Nahrungsnetz gibt es verschiedene trophische Ebenen, wobei die unterste Ebene die Primärproduzenten (oder Autotrophen) wie Pflanzen und Algen sind, die Energie und anorganisches Material in organische Verbindungen umwandeln, die dann vom Rest der Gemeinschaft genutzt werden können. Auf der nächsten Ebene befinden sich die Heterotrophen, d. h. die Arten, die Energie gewinnen, indem sie organische Verbindungen von anderen Organismen aufspalten. Heterotrophe, die Pflanzen verzehren, sind Primärkonsumenten (oder Pflanzenfresser), während Heterotrophe, die Pflanzenfresser verzehren, Sekundärkonsumenten (oder Fleischfresser) sind. Und diejenigen, die Sekundärkonsumenten fressen, sind Tertiärkonsumenten usw. Omnivore Heterotrophe sind in der Lage, auf mehreren Ebenen zu konsumieren. Schließlich gibt es noch die Zersetzer, die sich von den Abfallprodukten oder toten Körpern von Organismen ernähren. ⓘ
Im Durchschnitt beträgt die Gesamtenergiemenge, die pro Zeiteinheit in die Biomasse einer trophischen Ebene aufgenommen wird, etwa ein Zehntel der Energie der trophischen Ebene, die sie verbraucht. Abfälle und totes Material, das von Zersetzern verwendet wird, sowie Wärmeverluste durch den Stoffwechsel machen die anderen neunzig Prozent der Energie aus, die nicht von der nächsten trophischen Ebene verbraucht wird. ⓘ
Biosphäre

Im globalen Ökosystem (oder der Biosphäre) gibt es Materie in Form von verschiedenen interagierenden Kompartimenten, die je nach ihrer Form und ihrem Standort biotisch oder abiotisch sowie zugänglich oder unzugänglich sein können. So sind beispielsweise die Stoffe der terrestrischen Autotrophen sowohl biotisch als auch für andere Organismen zugänglich, während die Stoffe in Gesteinen und Mineralien abiotisch und unzugänglich sind. Ein biogeochemischer Kreislauf ist ein Weg, auf dem bestimmte Elemente der Materie umgewandelt oder durch die biotischen (Biosphäre) und abiotischen (Lithosphäre, Atmosphäre und Hydrosphäre) Kompartimente der Erde bewegt werden. Es gibt biogeochemische Zyklen für Stickstoff, Kohlenstoff und Wasser. In einigen Kreisläufen gibt es Reservoirs, in denen ein Stoff über einen langen Zeitraum verbleibt oder gespeichert wird. ⓘ
Der Klimawandel umfasst sowohl die durch die vom Menschen verursachte Emission von Treibhausgasen verursachte globale Erwärmung als auch die sich daraus ergebenden großräumigen Verschiebungen der Wettermuster. Zwar gab es auch früher schon Perioden des Klimawandels, doch seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat der Mensch einen noch nie dagewesenen Einfluss auf das Klimasystem der Erde ausgeübt und Veränderungen in globalem Maßstab verursacht. Die größte Ursache für die Erwärmung ist die Emission von Treibhausgasen, von denen mehr als 90 % Kohlendioxid und Methan sind. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) für den Energieverbrauch ist die Hauptquelle dieser Emissionen, zu denen auch die Landwirtschaft, die Abholzung von Wäldern und die Industrie beitragen. Der Temperaturanstieg wird durch Klima-Rückkopplungen beschleunigt oder abgemildert, z. B. durch den Verlust der das Sonnenlicht reflektierenden Schnee- und Eisdecke, den Anstieg des Wasserdampfs (selbst ein Treibhausgas) und die Veränderung der Kohlenstoffsenken an Land und im Meer. ⓘ
Naturschutz

Die Naturschutzbiologie befasst sich mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt der Erde mit dem Ziel, Arten, ihre Lebensräume und Ökosysteme vor übermäßigem Aussterben und der Erosion biotischer Wechselwirkungen zu schützen. Sie befasst sich mit den Faktoren, die die Erhaltung, den Verlust und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt beeinflussen, sowie mit der Wissenschaft von der Aufrechterhaltung der evolutionären Prozesse, die die genetische, populationsbezogene, artenbezogene und ökosystembezogene Vielfalt hervorbringen. Die Besorgnis rührt daher, dass Schätzungen zufolge in den nächsten 50 Jahren bis zu 50 % aller Arten auf der Erde verschwinden werden, was zu Armut und Hunger beiträgt und den Lauf der Evolution auf diesem Planeten neu bestimmen wird. Die biologische Vielfalt wirkt sich auf das Funktionieren der Ökosysteme aus, die eine Vielzahl von Leistungen erbringen, von denen die Menschen abhängig sind. ⓘ
Naturschutzbiologen erforschen und informieren über die Trends des Verlusts der biologischen Vielfalt, das Aussterben von Arten und die negativen Auswirkungen auf unsere Fähigkeit, das Wohlergehen der menschlichen Gesellschaft zu erhalten. Organisationen und Bürger reagieren auf die derzeitige Krise der biologischen Vielfalt mit Hilfe von Aktionsplänen zur Erhaltung der Artenvielfalt, die Forschungs-, Überwachungs- und Bildungsprogramme auf lokaler bis globaler Ebene vorsehen. ⓘ
Einteilung der Fachgebiete

Die Biologie als Wissenschaft lässt sich durch die Vielzahl von Lebewesen, Untersuchungstechniken und Fragestellungen nach verschiedenen Kriterien in Teilbereiche untergliedern: Zum einen kann die Fachrichtung nach den jeweils betrachteten Organismengruppen (Pflanzen in der Botanik, Bakterien in der Mikrobiologie) eingeteilt werden. Andererseits kann sie auch anhand der bearbeiteten mikro- und makroskopischen Hierarchie-Ebenen (Molekülstrukturen in der Molekularbiologie, Zellen in der Zellbiologie) geordnet werden. ⓘ
Die verschiedenen Systeme überschneiden sich jedoch, da beispielsweise die Genetik viele Organismengruppen betrachtet und in der Zoologie sowohl die molekulare Ebene der Tiere als auch ihr Verhalten untereinander erforscht wird. Die Abbildung zeigt in kompakter Form eine Ordnung, die beide Systeme miteinander verbindet. ⓘ
Im Folgenden wird ein Überblick über die verschiedenen Hierarchie-Ebenen und die zugehörigen Gegenstände der Biologie gegeben. In seiner Einteilung orientiert er sich an der Abbildung. Beispielhaft sind Fachgebiete aufgeführt, die vornehmlich die jeweilige Ebene betrachten. ⓘ
Botanik / Pflanzenwissenschaft
Die Botanik (auch Pflanzenwissenschaft) ging aus der Heilpflanzenkunde hervor und beschäftigt sich vor allem mit dem Bau, der Stammesgeschichte, der Verbreitung und dem Stoffwechsel der Pflanzen. ⓘ
Zoologie / Tierbiologie
Die Zoologie (auch Tierbiologie) beschäftigt sich vor allem mit dem Bau, der Stammesgeschichte, der Verbreitung und den Lebensäußerungen der Tiere. ⓘ
Humanbiologie
Die Humanbiologie ist eine Disziplin, die sich im engeren Sinn mit der Biologie des Menschen sowie den biologischen Grundlagen der Humanmedizin und im weiteren Sinn mit den für den Menschen relevanten Teilbereichen der Biologie befasst. Die Humanbiologie entstand als eigenständige Wissenschaftsdisziplin erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. ⓘ
Ihr verwandt ist die biologische Anthropologie, welche jedoch zur Anthropologie gezählt wird. Ziel der biologischen Anthropologie mit ihren Teilgebieten Primatologie, Evolutionstheorie, Sportanthropologie, Paläoanthropologie, Bevölkerungsbiologie, Industrieanthropologie, Genetik, Wachstum (Auxologie), Konstitution und Forensik ist die Beschreibung, Ursachenanalyse und evolutionsbiologische Interpretation der Verschiedenheit biologischer Merkmale der Hominiden. Ihre Methoden sind sowohl beschreibend als auch analytisch. ⓘ
Molekularbiologie

Die grundlegende Stufe der Hierarchie bildet die Molekularbiologie. Sie ist jene biologische Teildisziplin, die sich mit Molekülen in lebenden Systemen beschäftigt. Zu den biologisch wichtigen Molekülklassen gehören Nukleinsäuren, Proteine, Kohlenhydrate und Lipide. ⓘ
Die Nukleinsäuren DNA und RNA sind als Speicher der Erbinformation ein wichtiges Objekt der Forschung. Es werden die verschiedenen Gene und ihre Regulation entschlüsselt sowie die darin codierten Proteine untersucht. Eine weitere große Bedeutung kommt den Proteinen zu. Sie sind zum Beispiel in Form von Enzymen als biologische Katalysatoren für beinahe alle stoffumsetzenden Reaktionen in Lebewesen verantwortlich. Neben den aufgeführten Gruppen gibt es noch viele weitere, wie Alkaloide, Terpene und Steroide. Allen gemeinsam ist ein Grundgerüst aus Kohlenstoff, Wasserstoff und oft auch Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel. Auch Metalle spielen in sehr geringen Mengen in manchen Biomolekülen (z. B. Chlorophyll oder Hämoglobin) eine Rolle. ⓘ
Biologische Disziplinen, die sich auf dieser Ebene beschäftigen, sind:
- Biochemie,
- Genetik und Epigenetik (DNA-unabhängige Vererbung von Merkmalen),
- Molekularbiologie,
- Pharmazeutische Biologie und Toxikologie. ⓘ
Entwicklungsbiologie
Jedes Lebewesen ist Resultat einer Entwicklung. Nach Ernst Haeckel lässt sich diese Entwicklung auf zwei zeitlich unterschiedlichen Ebenen betrachten:
- Durch die Evolution kann sich die Form von Organismen im Laufe der Generationen weiterentwickeln (Phylogenese).
- Die Ontogenese ist die Individualentwicklung eines einzelnen Organismus von seiner Zeugung über seine verschiedenen Lebensstadien bis hin zum Tod. Die Entwicklungsbiologie untersucht diesen Verlauf. ⓘ
Physiologie
Die Physiologie befasst sich mit den physikalischen, biochemischen und informationsverarbeitenden Funktionen der Lebewesen. Physiologisch geforscht und ausgebildet wird sowohl in den akademischen Fachrichtungen Biologie und Medizin als auch in der Psychologie. ⓘ
Genetik
Als Begründer der Genetik gilt Gregor Mendel. So entdeckte er die später nach ihm benannten Mendelschen Regeln, die in der Wissenschaft allerdings erst im Jahr 1900 rezipiert und bestätigt wurden. Der heute weitaus wichtigste Teilbereich der Genetik ist die Molekulargenetik, die in den 1940er Jahren begründet wurde. ⓘ
Theoretische Biologie
Die Theoretische Biologie (auch Systemische Biologie) befasst sich mit mathematisch formulierbaren Grundprinzipien biologischer Systeme auf allen Organisationsstufen. ⓘ
Systembiologie
Die Systembiologie versucht, Organismen in Ihrer funktionellen Gesamtheit zu verstehen. Sie folgt der Systemtheorie und nutzt neben mathematischen Modellen auch Computersimulationen. Sie überschneidet sich mit der Theoretischen Biologie. ⓘ
Arbeitsmethoden der Biologie
Die Biologie nutzt viele allgemein gebräuchliche wissenschaftliche Methoden, wie strukturiertes Beobachten, Dokumentation (Notizen, Fotos, Filme), Hypothesenbildung, mathematische Modellierung, Abstraktion und Experimente. Bei der Formulierung von allgemeinen Prinzipien in der Biologie und der Knüpfung von Zusammenhängen stützt man sich sowohl auf empirische Daten als auch auf mathematische Sätze. Je mehr Versuche mit verschiedenen Ansatzpunkten auf das gleiche Ergebnis hinweisen, desto eher wird es als gültig anerkannt. Diese pragmatische Sicht ist allerdings umstritten; insbesondere Karl Popper hat sich gegen sie gestellt. Aus seiner Sicht können Theorien durch Experimente oder Beobachtungen und selbst durch erfolglose Versuche, eine Theorie zu widerlegen, nicht untermauert, sondern nur untergraben werden (siehe Unterdeterminierung von Theorien durch Evidenz). ⓘ
Einsichten in die wichtigsten Strukturen und Funktionen der Lebewesen sind mit Hilfe von Nachbarwissenschaften möglich. Die Physik beispielsweise liefert eine Vielzahl Untersuchungsmethoden. Einfache optische Geräte wie das Lichtmikroskop ermöglichen das Beobachten von kleineren Strukturen wie Zellen und Zellorganellen. Das brachte neues Verständnis über den Aufbau von Organismen und mit der Zellbiologie eröffnete sich ein neues Forschungsfeld. Mittlerweile gehört eine Palette hochauflösender bildgebender Verfahren, wie Fluoreszenzmikroskopie oder Elektronenmikroskopie, zum Standard. ⓘ
Als eigenständiges Fach zwischen den Wissenschaften Biologie und Chemie hat sich die Biochemie herausgebildet. Sie verbindet das Wissen um die chemischen und physikalischen Eigenschaften von den Bausteinen des Lebens mit der Wirkung auf das biologische Gesamtgefüge. Mit chemischen Methoden ist es möglich bei biologischer Versuchsführung zum Beispiel Biomoleküle mit einem Farbstoff oder einem radioaktiven Isotop zu versehen. Das ermöglicht ihre Verfolgung durch verschiedene Zellorganellen, den Organismus oder durch eine ganze Nahrungskette. ⓘ
Die Bioinformatik ist eine sehr junge Disziplin zwischen der Biologie und der Informatik. Die Bioinformatik versucht mit Methoden der Informatik biologische Fragestellungen zu lösen. Im Gegensatz zur theoretischen Biologie, welche häufig nicht mit empirischen Daten arbeitet, um konkrete Fragen zu lösen, benutzt die Bioinformatik biologische Daten. So war eines der Großforschungsprojekte der Biologie, die Genomsequenzierung, nur mit Hilfe der Bioinformatik möglich. Die Bioinformatik wird aber auch in der Strukturbiologie eingesetzt, hier existieren enge Wechselwirkungen mit der Biophysik und Biochemie. Eine der fundamentalen Fragestellungen der Biologie, die Frage nach dem Ursprung der Lebewesen (auch als phylogenetischer Baum des Lebens bezeichnet, siehe Abbildung oben), wird heute mit bioinformatischen Methoden bearbeitet. ⓘ
Die Mathematik dient als Hauptinstrument der theoretischen Biologie der Beschreibung und Analyse allgemeinerer Zusammenhänge der Biologie. Beispielsweise erweist sich die Modellierung durch Systeme gewöhnlicher Differenzialgleichungen in vielen Bereichen der Biologie (etwa der Evolutionstheorie, Ökologie, Neurobiologie und Entwicklungsbiologie) als grundlegend. Fragen der Phylogenetik werden mit Methoden der diskreten Mathematik und algebraischen Geometrie bearbeitet. ⓘ
Zu Zwecken der Versuchsplanung und Analyse finden Methoden der Statistik Anwendung. ⓘ
Die unterschiedlichen biologischen Teildisziplinen nutzen verschiedene systematische Ansätze:
- Mathematische Biologie: Aufstellen und Beweisen allgemeiner Sätze der Biologie.
- Biologische Systematik: Lebewesen charakterisieren und anhand ihrer Eigenschaften und Merkmale in ein System einordnen
- Physiologie: Zerlegung und Beschreibung von Organismen und ihren Bestandteilen mit anschließendem Vergleich mit anderen Organismen, mit dem Ziel einer Funktionserklärung
- Genetik: Katalogisieren und analysieren des Erbgutes und der Vererbung
- Verhaltensbiologie, Soziobiologie: Das Verhalten von Individuen, von artgleichen Tieren in der Gruppe und zu anderen Tierarten beobachten und erklären
- Ökologie: Beobachten einer oder mehrerer Arten in ihrem Lebensraum, ihrer Wechselbeziehung und den Auswirkungen biotischer und abiotischer Faktoren auf ihre Lebensweise
- Nutzansatz: die Zucht und Haltung von Nutzpflanzen, Nutztiere und Nutzmikroorganismen untersuchen und durch Variation der Haltungsbedingungen optimieren ⓘ
Anwendungsbereiche der Biologie
Die Biologie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin, die sehr viele Anwendungsbereiche hat. Durch biologische Forschung werden Erkenntnisse über den Aufbau des Körpers und die funktionellen Zusammenhänge gewonnen. Sie bilden eine zentrale Grundlage, auf der die Medizin und Veterinärmedizin Ursachen und Auswirkungen von Krankheiten bei Mensch und Tier untersucht. Auf dem Gebiet der Pharmazie werden Medikamente, wie beispielsweise Insulin oder zahlreiche Antibiotika, aus genetisch veränderten Mikroorganismen statt aus ihrer natürlichen biologischen Quelle gewonnen, weil diese Verfahren preisgünstiger und um ein Vielfaches produktiver sind. Für die Landwirtschaft werden Nutzpflanzen mittels Molekulargenetik mit Resistenzen gegen Schädlinge versehen und unempfindlicher gegen Trockenheit und Nährstoffmangel gemacht. In der Genussmittel- und Nahrungsmittelindustrie sorgt die Biologie für eine breite Palette länger haltbarer und biologisch hochwertigerer Nahrungsmittel. Einzelne Lebensmittelbestandteile stammen auch hier von genetisch veränderten Mikroorganismen. So wird das Lab zur Herstellung von Käse heute nicht mehr aus Kälbermagen extrahiert, sondern mikrobiell erzeugt. ⓘ
Weitere angrenzende Fachgebiete, die ihre eigenen Anwendungsfelder haben, sind Ethnobiologie, Bionik, Bioökonomie, Bioinformatik und Biotechnologie. ⓘ